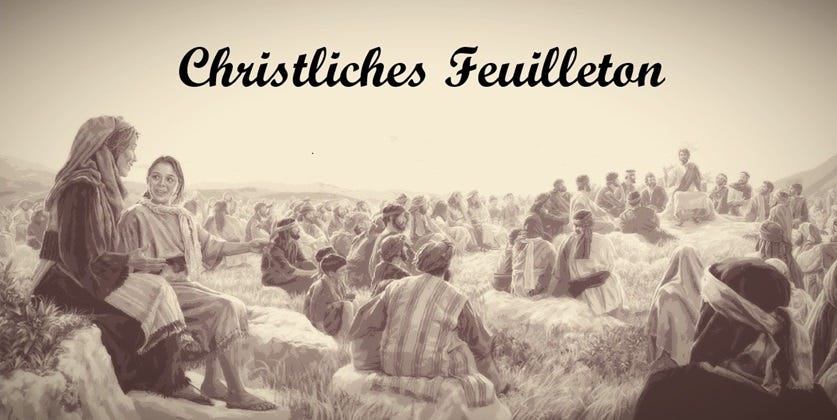Das Leben am Königshof in Jerusalem und Samaria II
02.07.2025 Was archäologische und schriftliche Zeugnisse verraten. Teil 2
Wie lebten und wohnten die Könige Israels und Judas? Wie organisierten sie ihre verhältnismäßig kleinen Reiche? Was wissen wir heute über Alltag und Lebensumstände von Männern und Frauen am Hof? Dank der zahlreichen archäologischen Ausgrabungen in den einstigen Hauptstädten Samaria und Jerusalem können wir ein wenig Licht in diese Welt bringen.
Frauen am Königshof
Berühmt sind die angeblich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen des Salomo (1.Kön 11,3) – eine maßlos übertriebene Zahl, die die Bedeutung des Königs verherrlichen wollte. Etwas realistischer sind die mindestens acht Frauen Davids (namentlich genannt Achinoam, Abigail, Maacha, Haggit, Abital, Egla, Michal, Batseba sowie weitere namenlose Frauen). Hochzeiten mit den Töchtern einflussreicher Männer dienten dem Aufbau der Machtstrukturen Davids. In späterer Zeit wird es weniger Königsgattinnen gegeben haben. Ob die Angaben der Chronik stimmen, wonach Rehabeam 18 Frauen und 60 Nebenfrauen hatte (2.Chr 11,21) und Abija 14 Frauen (2.Chr 13,21), kann durchaus bezweifelt werden. Nur selten erfahren wir bei den späteren Königen von mehreren Frauen (jeweils zwei Frauen des Joasch in 2 Chr 24,3 und des Joschija in 2 Kön 23,31.36). Trotzdem scheinen mehrere Königsfrauen auch in späterer Zeit noch normal gewesen zu sein (Dtn 17,17).
Eine besondere Rolle scheint – wie übrigens auch am ägyptischen Königshaus – in Jerusalem die Königinmutter gespielt zu haben. Im Gegensatz zum Nordreich Israel werden bei den Thronbesteigungsnotizen des Südreichs Juda fast alle Mütter der Könige genannt, etwa Amazjas Mutter Joaddan, Asarjas Mutter Jecholja, Hiskijas Mutter Abi, Joschafats Mutter Asuba, Josias Mutter Jedida ... Die Königinmutter war wohl enge Beraterin des Königs und genoss daher hohes Ansehen.
Das königliche Personal
Die Beamtenschaft um den König herum war anfangs relativ klein und wurde erst im Laufe der Zeit weiter ausgebaut (vgl. Tabelle unten). Die personelle Ausstattung des Königshauses mit Beamten war – abgesehen vom Heer – geringer als in mancher heutigen Dorfverwaltung. Der Palast hatte in vorexilischer Zeit architektonisch neben dem Tempel eine herausragende Stellung inne, das Königshaus und der Beamtenapparat waren aber zahlenmäßig sehr beschränkt. Die Tabelle (unten) zeigt deutlich, wie sich das Königtum entwickelt hat. Zum engsten Stab um den König gehörten nur wenige „Minister“. Eine wichtige Rolle spielte der Kanzler, wohl eine Art Chefsekretär, der sich um den ordnungsgemäßen Ablauf der Staatsgeschäfte kümmerte. Palastvorsteher waren für die Instandhaltung des Palastes zuständig und eine Art besserer Hausmeister.
Die Zahl der Schreiber entwickelte sich im Laufe der Zeit rasant. Sowohl in Hazor als auch in Samaria sind im 9. Jh. v.C bereits jeweils sechs Schreiberkammern mit wohl ebenso vielen Schreibern archäologisch belegt. Den Schreibern unterstand vor allem die komplette Verwaltung – z. B. Annahme und Registrierung von Abgaben an den Palast – und die Abwicklung des Schriftverkehrs. Die zahlreichen Bullen, also Siegelabdrücke, die wir inzwischen vor allem aus Jerusalem kennen, belegen einen intensiven Schriftverkehr. Die zugehörigen Papyri, die gefaltet, mit einer Schnur umwickelt und dann gesiegelt wurden, haben sich aber leider nicht erhalten. Allerdings konnten nur vielleicht 5 % der Bevölkerung lesen und schreiben. Hierzu gehören nahezu ausschließlich neben den Schreibern und den Priestern die Soldaten. Zu den Aufgaben der Schreiber wird auch eine Art „Geheimdienst“ gehört haben: Diplomaten und Händler wurden ausgefragt, um aktuelle Nachrichten über die Ereignisse in den Nachbarländern zu erhalten. Diese wurden wohl schriftlich festgehalten, um darauf jederzeit zurückgreifen zu können.
Eine wichtige Position hatte auch der Oberaufseher der Fronarbeit, vielleicht mit einem heutigen Finanzminister vergleichbar. Da es noch keine Steuern gab (als einmalige Steuer ist erstmals unter König Menahem von Israel eine Abgabe von 50 Silberschekeln für eine Tributzahlung an die Assyrer belegt, vgl. 2.Kön 15,20), war es notwendig, den pflichtmäßigen Arbeitseinsatz der Bevölkerung für das Gemeinwohl in den Städten zu organisieren. Hierzu gehörten z. B. Bauaktivitäten an Mauern und andere Infrastrukturmaßnahmen, aber auch an den lokalen Palästen für die Stadtobersten. Der Großteil der Verwaltung geschah offenbar dezentral in den einzelnen Orten und wurde weitgehend von den Ortsältesten geleistet. Das Königshaus hatte damit nichts zu tun. Trotzdem sollte das Reich auch kontrolliert werden. Für die Kleinstaaten Israel und Juda war es daher sinnvoll, an zentralen und größeren Orten Stadtoberste einzusetzen, die das regionale Geschehen im Auftrag des Königs zu überwachen hatten. Paläste dieser Stadtobersten sind z. B. aus Hazor, Megiddo, Tirza oder Jericho bekannt Eine wichtige Aufgabe hatte das Heer inne. Neben dem Amt des Heerführers wurden im Nord- und Südreich zusätzlich Anführer über 50 bzw. 100 Infanteristen sowie über die Streitwagen eingeführt. Eine wichtige Aufgabe hatten die „Läufer“, die nach der Reichsteilung die Leibwache des Königs bildeten. Der Name rührt wohl daher, dass sie mit dem Wagen des Königs mitliefen, wenn er auf dem Streitwagen unterwegs war.
König und Tempel – kein unproblematisches Verhältnis
Das Verhältnis zwischen Königshaus und Tempel war nicht unproblematisch. Einerseits wurde der aktuelle König als Stellvertreter Gottes verstanden. Er war von Gott eingesetzt, nach Ps 2,7 wurde er sogar als Sohn Gottes verstanden. Er hatte im Sinne Gottes zu regieren, er sollte die göttlichen Vorstellungen realisieren. Aus diesem Grund war auch das Heer so wichtig. Der äußere Schutz des Reiches wurde mit dem Schutz Gottes für sein Volk gleichgesetzt. Innenpolitisch war es Aufgabe des Königs, den Kult und damit die Gottesverehrung aufrechtzuerhalten. Dies implizierte Gaben an den Tempel und regelmäßige Baumaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Kultes. Nur wenn die Verehrung Gottes in einer angemessenen Weise durchgeführt werden konnte, konnte Gott auch seinen Segen auf das Land legen. Der König stand somit in göttlicher Verantwortung und hatte den göttlichen Ansprüchen zu genügen. Dies erforderte eine enge Verbindung zum Wohnort Gottes, also zum Tempel.
Andererseits scheinen die Tempelpriester auch bemüht gewesen zu sein, möglichst unabhängig vom König zu agieren. Nach 2.Kön 11,2-6 wurde der Knabe Joasch sechs Jahre im Tempel versteckt, ohne dass das benachbarte Königshaus dies wahrnahm. Dies war wohl nur möglich, wenn weder der König noch sein Heer freien Zutritt zum Tempel hatten. Neue Installationen im Tempelbereich konnten zwar vom König in Auftrag gegeben werden, wurden aber vom Hohepriester umgesetzt (vgl. 2.Kön 16,10-11, wo Ahas dem Priester Urija anordnet, einen Altar zu bauen). Wohl deshalb entzogen sich die Könige ihrer Verantwortung, für die Instandhaltung des Tempels zu sorgen: Reparaturmaßnahmen am Tempel sollten ab König Joasch aus den freiwilligen Gaben, die für den Tempel geopfert wurden, bezahlt werden (2.Kön 12,5-13; 22,4-7). Lediglich den Auftrag für die Baumaßnahmen vergab noch der König. Für die Beschaffung der Finanzen war der Tempel selbst zuständig.
Ausblick
Wer sich die Könige Judas und Israels ähnlich wie diejenigen in Märchen vorstellt, hat ein falsches Bild vom damaligen Königtum. Zwar bildeten der König und seine Minister eine Elite im Lande, der es relativ gut ging. Sie erhielten Abgaben und konnten ihr Leben sicherlich angenehmer gestalten als die normale Bevölkerung. Trotzdem war diese Elite zahlenmäßig klein, und die Abgaben an das Königshaus sollten auch die gesamte Beamtenschaft und das Heer mitversorgen. Ohnehin war die Zahl der Untergebenen nicht allzu groß: Im 8. Jh. vor der assyrischen Eroberung lebten nach zuverlässigen Schätzungen vielleicht 300.000 Menschen in Israel. Die wesentlichen Aufgaben des Königs waren letztendlich Managementaufgaben:
• Er hatte außenpolitisch für gute diplomatische Beziehungen zu sorgen und gegebenenfalls in Kriegszeiten auch die militärische Unterstützung durch befreundete Länder sicherzustellen;
• er musste innenpolitisch für Infrastrukturmaßnahmen sorgen, damit das Leben der Bevölkerung sich entwickeln konnte;
• er musste durch sein Heer für Ruhe, Ordnung und sichere Handelswege sorgen, aber auch gleichzeitig die Finanzierung des Heeres, das teilweise durch Söldner gestellt wurde, gewährleisten;
• er musste sich um ein gutes Gottesverhältnis kümmern, um irdischer Statthalter Gottes zu sein.
All dies realisierten die biblischen Könige mal besser, mal schlechter. Nur wenige erreichten in den Augen ihrer Zeitgenossen diese hochgesteckten Ziele, was immer wieder zu Kritik der Propheten führte, aber sicherlich auch weiter Kreise der Bevölkerung.
[Prof. Dr. Wolfgang Zwickel ist Professor für Altes Testament und Biblische Archäologie an der Universität Mainz]