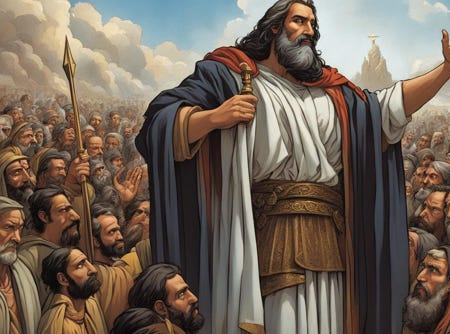David und Salomo
05.03.2025 Beispiele für interessengeleitete Erkenntnis
Wenn biblische Erzählungen durch Ausgrabungsergebnisse bestätigt werden, erklären dies die Ausgräber gern zur Sensation. Und wenn es dabei auch noch um so wichtige Persönlichkeiten geht wie David und Salomo, werden Entdeckungen schnell in der Weltpresse diskutiert. Doch Vorsicht – bisweilen ist interessengeleitete Erkenntnis im Spiel.
Vom großen Reich Davids und Salomos, dem vereinigten Königreich aus Israel (im Norden) und Juda (im Süden), wurden bereits 1925–1939 in Megiddo vermeintliche Spuren durch die amerikanische „Chicago Expedition“ aufgefunden: Pferdeställe (Pfeilerhäuser mit Futtertrögen und Lochungen zum Anbinden von Tieren), ein Stadttor aus sechs Kammern, das den Toren von Hazor und Gezer ähnelte, sowie eine 820 m lange Stadtmauer. Dieses Megiddo war also eine der Reichsstädte, über die König Salomo ein ganzes Menschenalter lang – also volle 40 Jahre – herrschte. Die „Chicago Expedition“ fand, was im Alten Testament zu lesen war: „ ... König Salomo hatte Fronarbeiter ausgehoben zum Bau des Tempels, seines Palastes, des Millo und der Mauern von Jerusalem, Hazor, Megiddo und Gezer. Salomo baute ... alle Vorratsstädte, die ihm gehörten, die Städte für die Wagen und ihre Mannschaft ...“ (1.Kön 9,15-19). Nun schien der biblische Bericht bestätigt und durch archäologische Funde belegt.
Doch die Harmonie zwischen dem Text und den Ausgrabungsergebnissen hielt nicht lange an. Die Zuordnung zwischen beiden musste in Megiddo ein erstes Mal korrigiert werden, als der berühmte israelische Ausgräber und General Yigael Yadin aufgrund von detaillierten Keramikstudien und seiner Grabungen in den 1960er-Jahren die von der „Chicago Expedition“ in eins geworfenen Ausgrabungsschichten von der Ära Salomos bis zur assyrischen Eroberung 732 vC überprüfte und sie zwei Bauperioden zuteilte: der Zeit Salomos im 10. Jh. vC und der Epoche der omridischen Dynastie Israels im 9. Jh. vC. Die Stadtbefestigungen, die Wasseranlage und die Pferdeställe wurden nun später datiert, nämlich in die Zeit nach dem Wiederaufbau des vom ägyptischen Pharao Scheschonq I. (945–924 vC) im Jahr 926 vC zerstörten Megiddo, in dem Yadin eine Streitwagen-Garnison vermutete. Heute tritt Israel Finkelstein von der Universität Tel Aviv mit guten Gründen für eine noch spätere Datierung ein.
Wie das Alte Testament von seinen Königen berichtet
Die alttestamentlichen Erzählungen über David und Salomo sind mitnichten vom Himmel gefallen. Sie stammen aus der Feder von späteren Schreibern, die u. a. königliche Annalen für die Nachwelt schrieben. Hin und wieder zitiert auch das Alte Testament daraus. Diese Schreiber interpretierten ihre Zeit und die ihrer Vorfahren aus ihrem eigenen Blickwinkel. Dies lässt sich leicht an der Darstellung des Reiches und der Macht des Reichsgründers – des Königs David – nachvollziehen. Dabei ist zu bemerken: Je größer die zeitliche Distanz zwischen den Schreibern und der eigentlichen Königsherrschaft ist, desto überschwänglicher können sie ihre Vorstellungen in die Texte einbringen. Reichte ihnen zunächst das vereinigte Königreich Israel und Juda „von Dan bis Beerscheba“ (Ri 20,1), so propagierten sie im 7. und 6. Jh. vC, ein knappes halbes Jahrtausend nach Davids Regierung: „Von der Wüste bis zum Libanon, und vom großen Euphratstrom bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang“ (Jos 1,4). Ein Königreich dieser Ausdehnung hat ein israelitischer Monarch niemals auch nur annähernd beherrscht. Im hymnisch-orientalischen Hofstil am Tempel von Jerusalem rezitierten die Priester im Rückgriff auf eine vermeintlich goldene Vergangenheit und in der Hoffnung auf eine noch gewaltigere Zukunft: „Und er wird herrschen von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde“ (Ps 72,8).
Dieser gestalterische Umgang mit der Überlieferung passt zur Beobachtung, dass die beiden israelitischen Könige David und Salomo im Vergleich zu ihren eher „durchwachsenen“ Darstellungen in den Samuel- und Königsbüchern in den deutlich späteren Chronikbüchern zu Musterbeispielen königlicher Tugenden und Gottesverehrung heranreiften – weise, gottgefällig und über alle moralischen Zweifel erhaben. Ihre ehedem geschilderten Makel wurden offenbar aus dem kollektiven Gedächtnis gestrichen.
Gab es David und Salomo wirklich?
Diese und weitere Inkonsistenzen brachten das Bild des davidischen und salomonischen Großreichs ins Wanken. So konnten beispielsweise diverse bisher unternommene Grabungen in Jerusalem – trotz bisweilen anderslautender Interpretation – keinen prächtigen königlichen Ausbau, ja nicht einmal größere Bauten aus dem 10. Jh. vC wirklich sicher nachweisen. Da es aber genügend Belege für frühere wie auch spätere Befestigungen gibt, lässt sich ihr Fehlen im 10. Jh. vC auch nur schwerlich damit erklären, dass gerade diese Mauern durch spätere Bautätigkeit entfernt wurden. Wenn das Großreich Davids und Salomos aber angezweifelt werden kann – jedenfalls in der im Alten Testament geschilderten Form – und es sich bei den entsprechenden Berichten um nachträgliche Projektionen späterer Jerusalemer Schreiber handelt, dann können auch weitergehende Schlussfolgerungen nicht ausbleiben. So haben besonders kritische Bibelausleger bisweilen sogar die schiere Existenz der Könige David und Salomo infrage gestellt. Einige Forscher etwa deuteten das davidische Königtum allein als „theologisches Konstrukt“ ohne jeden Bezug zur Realität.
Doch zumindest diese Extremposition konnte durch den Fund von drei Bruchstücken der sogenannten Tel-Dan-Stele in den 1990ern widerlegt werden. Als in ihrer geschichtlichen Existenz bewiesen gilt eine Person in der wissenschaftlichen Forschung erst dann, wenn sie in zwei unabhängigen Quellen belegt werden kann. Das ist für David gegeben – für seinen Sohn Salomo nicht. Was bedeutet das? Es bedeutet schlicht, dass die Geschichtswissenschaft stets Rechenschaft darüber ablegen muss, was sie konkret sicher belegen und was sie – trotz hoher Wahrscheinlichkeit – nur als These anerkennen kann.
Der Streit um David und Salomo – neue Grabungen und dennoch kein Ende
Die Debatte über die historische Rolle Davids und Salomos ist weit davon entfernt, letztgültig entschieden zu sein; im Gegenteil – sie setzt sich gegenwärtig ungebrochen fort. Aktuell stehen die 2007 begonnenen Grabungen in Chirbet Qeiyafa im Fokus dieser Diskussionen. Sie illustrieren den Konflikt zwischen maximalistischer und minimalistischer Auslegung der archäologischen Befunde und greifen die Frage nach der Ausdehnung des im Alten Testament beschriebenen davidischen Großreichs erneut auf. Die Hauptprotagonisten dieser Debatte sind der Ausgräber von Chirbet Qeiyafa, Yosef Garfinkel von der Hebräischen Universität Jerusalem, auf der maximalistischen Seite und der minimalistisch gesinnte Israel Finkelstein von der Universität Tel Aviv. Yosef Garfinkel sieht in den Ergebnissen seiner Grabungen Belege dafür, dass das etwa 32 km südwestlich von Jerusalem im Elah-Tal gelegene Chirbet Qeiyafa mit dem aus Jos 15,36; 1.Sam 17,52 und 1.Chr 4,31 bekannten Schaaraim zu identifizieren sei. Es sei zur biblisch angenommenen Regierungszeit Davids errichtet und von Judäern bewohnt worden. Der Ort sei eine Festungsstadt zum Schutze Judas vor den im angrenzenden Gebiet lebenden Philistern und neben Jerusalem und Hebron eines der wichtigsten städtischen Zentren Judas gewesen.
Israel Finkelstein jedoch schließt aufgrund architektonischer Gegebenheiten die Zugehörigkeit Chirbet Qeiyafas zum Südreich aus. Der Ort wäre sonst als die einzige gut ausgebaute Stadt Judas dieser Zeit (einschließlich Jerusalems!) anzusehen. Die Stadt verkörpere aus dem Norden kommende Traditionen und sei eher mit einer politischen Größe des erstarkenden nördlichen Berglandes zu verbinden.
Diese widerstreitenden Theorien belegen die Kontrahenten angesichts einer absolut gleichen Quellenlage mit folgenden widerstreitenden Argumenten: Grundsätzlich wirft Israel Finkelstein dem Team von Garfinkel eine viel zu schnelle Ausgrabungstätigkeit mit zu vielen unausgebildeten Volontären vor. In einer zweiwöchigen Ausgrabung wurden 2007 allein 2,50 m Erdschicht trotz schwierig zu grabender Hanglage bis zum Felsen herabgegraben. Im Gegensatz dazu stellt er die Grabung in Megiddo dar, wo für eine Grabungswoche statt der 1,25 m von Chirbet Qeiyafa auf einer Fläche gleicher Größe weniger als 10 cm veranschlagt werden. Die angeblich hellenistische Stadtmauer Chirbet Qeiyafas sei in Wirklichkeit eine moderne, landwirtschaftlich genutzte Feldmauer.
Es stellt sich die Frage, aus welchem Grund Leben und Wirken von David und Salomo im Alten Testament so ausführlich und ausgeschmückt dargestellt werden, obwohl doch ein großer Teil der hier berichteten Ereignisse und Sachverhalte bei historischen Nachfragen zumindest angezweifelt werden kann. Offenkundig scheint es den im 7. Jh. vC lebenden Autoren, die mit David und Salomo (und ihren Nachfolgern) über Personen und Ereignisse berichteten, die zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Hundert Jahre zurücklagen, um die eigene zeitgenössische Politik gegangen zu sein. Ende des 8. Jh. vC wurde das Nordreich Israel von den Assyrern erobert und in eine Provinz umgewandelt. Im Zuge dieser Ereignisse flohen viele Menschen in das Südreich Juda, was soziale Probleme und Spannungen zur Folge hatte. Das Konzept des vereinigten davidischen Königreichs war wohl der Versuch, eine pan-israelitische Geschichte zu entwerfen, um durch die Beschwörung einer gemeinsamen glücklichen Vergangenheit die Möglichkeit eines auch künftigen friedlichen Zusammenlebens aufzuzeigen. Die Berichte von Salomos Handels- und Außenpolitik hingegen könnten im Zusammenhang mit der zeitweiligen Unterwerfung Judas unter das übermächtige Assyrien Ende des 8. und Anfang des 7. Jh. vC verständlich werden. Gute Beziehungen zur Großmacht sorgten zwar für einen Aufschwung des Handels, wurden aber nicht nur als positiv angesehen. Man bedenke, dass es auch im Kult eine starke assyrische Einflussnahme gab! In dieser Situation scheinen die Erzählungen von Salomos friedfertiger und auf Handel ausgerichteter Herrschaft – man denke etwa an den Besuch der Königin von Saba – eine solche Politik legitimieren zu wollen, indem sie zu zeigen versuchen, dass auch die unbestreitbar großen Könige Israels bereits ähnlich gehandelt haben.
[Autorin: Andrea Gropp war Mitglied des Tall Zira’a-Teams von 2003 bis 2011. Sie promovierte 2014 über die religionsgeschichtliche Entwicklung Nordpalästinas von der Frühen Bronzezeit bis zum Ende der Eisenzeit am Beispiel des Tall Zira’a]