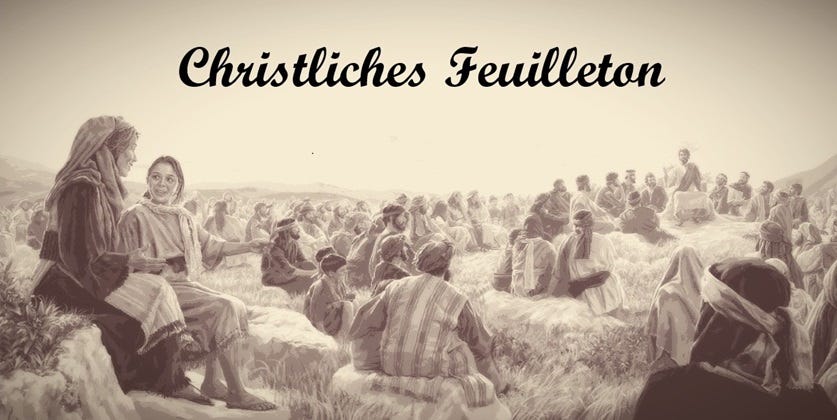Die Archäologie der Königszeit I
10.06.2025 Der neue Blick auf die Geschichte der Staaten Israel und Juda. Teil 1
Wer das Alte Testament liest, erhält den Eindruck, dass das Königreich von Jerusalem von Beginn der Königszeit an sehr bedeutsam, geradezu weltberühmt ist. Tatsächlich aber entstand das Königreich Israel viel früher und war lange Zeit weitaus einflussreicher. Die Könige in Jerusalem waren ihren Kollegen in Samaria unterlegen. Anhand archäologischer Funde kann man die Geschichten der beiden Kleinstaaten Stück für Stück wie ein Puzzle zusammensetzen.
Um die Geschichte der Königreiche Israel und Juda zu verstehen, muss man in eine Zeit zurückgehen, in der es diese noch nicht gab. Denn was in der altorientalischen Welt ab dem 9. Jh. vC als Israel und im 8. Jh. vC als Juda bekannt wurde, gehörte im 14./13. Jh. vC zu den spätbronzezeitlichen Stadtstaaten, die unter ägyptischer Oberhoheit standen. Neben bedeutungsvollen – wie Gaza, Megiddo oder Hazor – gab es kleinere Stadtstaaten, die zwar über eine große Fläche verfügten, politisch jedoch kaum eine Rolle spielten. Zu diesen gehörten der Stadtstaat von Sichem im Norden und der Stadtstaat von Jerusalem im Süden. In einem Satz gesagt, sind die beiden Königtümer von Samaria und Jerusalem, traditionell als „Nordreich Israel“ und „Südreich Juda“ bezeichnet, aus diesen beiden Stadtstaaten hervorgegangen.
Die Stadtstaaten Sichem und Jerusalem
Die Archäologie belegt, dass der Norden mit Sichem schon in der Frühzeit Israels bedeutungsvoller war als der Süden mit Jerusalem. Die neuen Siedlungen, die im 12./11. Jh. vC in diesem Gebiet entstanden und vermutlich mit der sogenannten „Landnahme“ des Volkes Israel zu verbinden sind, lagen zu einem Großteil auf dem Gebiet des Stadtstaates Sichem und zu einem deutlich geringeren Teil auf dem Territorium des Stadtstaates Jerusalem. Hinzu kommt, dass die älteste außerbiblische Erwähnung des Namens „Israel“ auf den Norden verweist und nicht etwa auf den Süden mit Jerusalem: In der ägyptischen Stele des Pharao Merenptah aus dem Jahr 1208 vC wird eine Personengruppe mit Namen Israel genannt. Wer sich hinter der Gruppe verbirgt, wird kontrovers diskutiert, doch vermutlich lebte sie in der Nähe von Bet Schean, einer ägyptischen Garnisonsstadt gut 37 km südlich vom See Gennesaret. Insofern erstaunt nicht, dass der Name „Israel“ mit dem Königtum im Norden verbunden wurde und nicht mit dem im Süden. Die Geschichte der beiden Königtümer zeigt, dass entgegen der biblischen Darstellung das Königtum im Norden wesentlich bedeutungsvoller war als das Königtum in Jerusalem.
Kultureller Aufschwung zuerst im Norden: das Königreich Israel im 9. Jh. vC
Die Entstehung des Königreichs Israel steht im Kontext der allgemeinen kulturellen Entwicklung im 10./9. Jh. vC. Aus den kleinen politischen Einheiten auf dem Boden der alten Stadtstaaten entstanden größere Königreiche. Ein wesentlicher Faktor dafür war der internationale Fernhandel. Im 10. Jh. vC schufen die Phönizier im Mittelmeerraum weitreichende Handelsverbindungen, die unter anderem Ägypten, Zypern und die Ägäis umfassten. So entstanden panmediterrane Handelsnetzwerke, die Auswirkungen auf die Entwicklung im Landesinneren hatten. Denn der Ausbau eines kleinen Herrschaftsgebietes zu einem großen Königreich setzte Handelskontakte voraus, die ohne die Phönizier nicht möglich waren. Dies gilt auch für das Königreich Israel, das unter König Omri (882–871 vC) und seiner Dynastie zu internationaler Bedeutung gelangte. Beleg dafür ist die Mescha-Stele, auf der Omri und sein Sohn zusammen mit andern Playern der Region in einem auswärtigen Dokument genannt werden.
In einer im Jahr 2019 von dem israelischen Archäologen Omer Sergi durchgeführten Ausgrabung in einem Ort in der Jesreel-Ebene namens Horvat Tevet wurden archäologische Hinweise auf eine überregionale Getreideproduktion gefunden. Hier muss weitaus mehr verarbeitet worden sein, als die Einwohner selbst brauchten. Der Ort wurde vermutlich von den Omriden kontrolliert, die Getreide an die phönizischen Küstenstädte lieferten. Folgt man dem deutsch-israelischen Archäologen Gunnar Lehmann, so gab es im 9. Jh. vC ein „Joint Venture“ zwischen Omriden und Phöniziern: Erstere lieferten Getreide, letztere Luxusware aus dem internationalen Fernhandel, wie etwa Amulette, Perlen oder Elfenbein, die bis nach Samaria gelangten. Dazu passt auf Seiten des biblischen Befundes das in 1.Kön 22,39 genannte Elfenbeinhaus von Omris Sohn Ahab. Ein weiterer Hinweis auf die engen Verbindungen zwischen den Königen Israels und den Phöniziern könnte die polemische Notiz in 1.Kön 16,31 über die Hochzeit Ahabs mit der phönizischen Prinzessin Isebel sein.
In Horvat Tevet wurde ein monumentales Gebäude ausgegraben, das in einem Baustil errichtet wurde, der auf die Omriden verweist. Vergleichbare Architektur ist in Jesreel und Samaria belegt. Der biblischen Darstellung in 1.Kön 16,24 zufolge hat König Omri die Stadt Samaria zur Hauptstadt des Reiches Israel ausbauen lassen. Samaria lag verkehrstechnisch günstig an der Ost-West-Verbindung zur Küstenebene und hatte Zugang zur Nord-Süd-Achse, die von der Jesreel-Ebene über Bet Schean bis nach Jerusalem reichte. Unter Omri wurde in Samaria eine Palastanlage aus großen Quadersteinen geschaffen. Vergleichbare Architektur ist in Sichem, Tirza, Penuel und in den bedeutenden Städten Megiddo und Hazor belegt. Während die ältere Forschung die berühmten „Sechskammertore“ von Megiddo und Hazor noch mit König Salomo verbinden wollte, werden diese nunmehr im Kontext der omridischen Bauaktivitäten verortet. Es waren die Könige von Samaria, die im 9. Jh. Bauten errichten ließen, die keine lokalen Vorläufer hatten. Vielmehr zeigt sich, wie jüngere Forschungen ergeben haben, phönizischer Einfluss.
Jerusalem im 10. und 9. Jh. vC: langsame Entwicklung in Abhängigkeit von Samaria
Die kulturelle Entwicklung im Norden erfasste mit gut 30 bis 50 Jahren Verzögerung auch das Königtum von Jerusalem. Jerusalem war eine alte Bergfestung, die bereits im 18. Jh. vC inschriftlich belegt ist. Der historische Kern der Stadt lag auf dem Südosthügel, der sogenannten „Davidstadt“, und war mit 250 m Länge und 50–70 m Breite recht klein. Will man den biblischen Berichten einen historischen Kern entnehmen, so wurde die Bergfestung Jerusalem unter David israelitisch und unter Salomo um einen kleinen Tempel ergänzt. Die entscheidenden Veränderungen vollzogen sich, wie Forschungen der israelischen Archäologen Joe Uziel und Yuval Gadot ergeben haben, jedoch erst ab dem 9. Jh. vC. So wurde die monumentale „stepped stone structure“ in der Davidstadt, eine gut 50 x 27 m große Steinkonstruktion aus vordavidischer Zeit, im 9. Jh. vC ausgebaut und mit einem fein gestuften Pflaster umgeben. Der archäologische Befund wird durch Siegelamulette aus Ausgrabungen nahe der Gihonquelle ergänzt, die auf Schriftlichkeit und eine offizielle Verwaltung im 9. Jh. vC verweisen.
Beides gibt Hinweise darauf, dass im 9. Jh. vC in Jerusalem eine kulturelle Entwicklung einsetzte, die mit dem Aufbau eines Königtums zu verbinden ist. Interessanterweise fand sich im Gegensatz zu Samaria und anderen Orten im Norden in Jerusalem und seinem Umland keine Luxusware aus dem internationalen Fernhandel, wie edle Keramik, Elfenbeine oder Perlen. Stattdessen wurde Alltagsware gefunden, wozu größere Mengen Fischknochen gehören. Aktuelle Forschungen des britischen Archäologen Bruce Routledge haben gezeigt, dass in Ägypten produzierter Fisch, der sogenannte Nilbarsch, in größeren Mengen in der südlichen Levante verzehrt wurde. Dies gilt auch für Jerusalem, wo aus dem 9. und 8. Jh. vC erstaunlich große Mengen von Nilbarschknochen gefunden wurden.
Wie aber sind die monumentale Architektur im Jerusalem des 9. Jh. vC und die großen Mengen an Fisch aus dem Fernhandel zu erklären? Verbindet man den archäologischen Befund mit den alttestamentlichen Angaben, so spricht einiges dafür, dass der eigentliche Motor für die kulturelle Entwicklung Jerusalems im Norden zu suchen ist. Die alttestamentlichen Königsbücher berichten von engen Beziehungen zwischen den Königen von Samaria und denen von Jerusalem. So war beispielsweise die Gemahlin des Jerusalemer Königs Joram, Prinzessin Atalja, eine Omridin (2.Kön 18,18.26). Will man den komplexen alttestamentlichen Befund in einem Satz zusammenfassen, so standen die Könige Jerusalems ab Joschafat (868–847 vC) für gut einhundert Jahre (bis Jotam, 756–741 vC) in einem Vasallenverhältnis zu den Königen Israels. Die hohe Bedeutung eines Königs von Samaria gegenüber einem Herrscher von Jerusalem wird in einer aramäischen Inschrift aus dem Jahr 830 vC greifbar. Diese spricht mit Blick auf den Norden von einem „König von Israel“ und mit Blick auf den Süden lediglich von einem „König vom Haus Davids“. Ein „König von Juda“ ist in einer altorientalischen Inschrift erstmals für das Jahr 738 vC belegt.
- Teil 2 folgt nächste Woche -
[Prof. Dr. Dr. Bernd U. Schipper ist Professor für Altes Testament mit dem Schwerpunkt Geschichte Israels in der altorientalischen Welt an der Humboldt-Universität zu Berlin.]