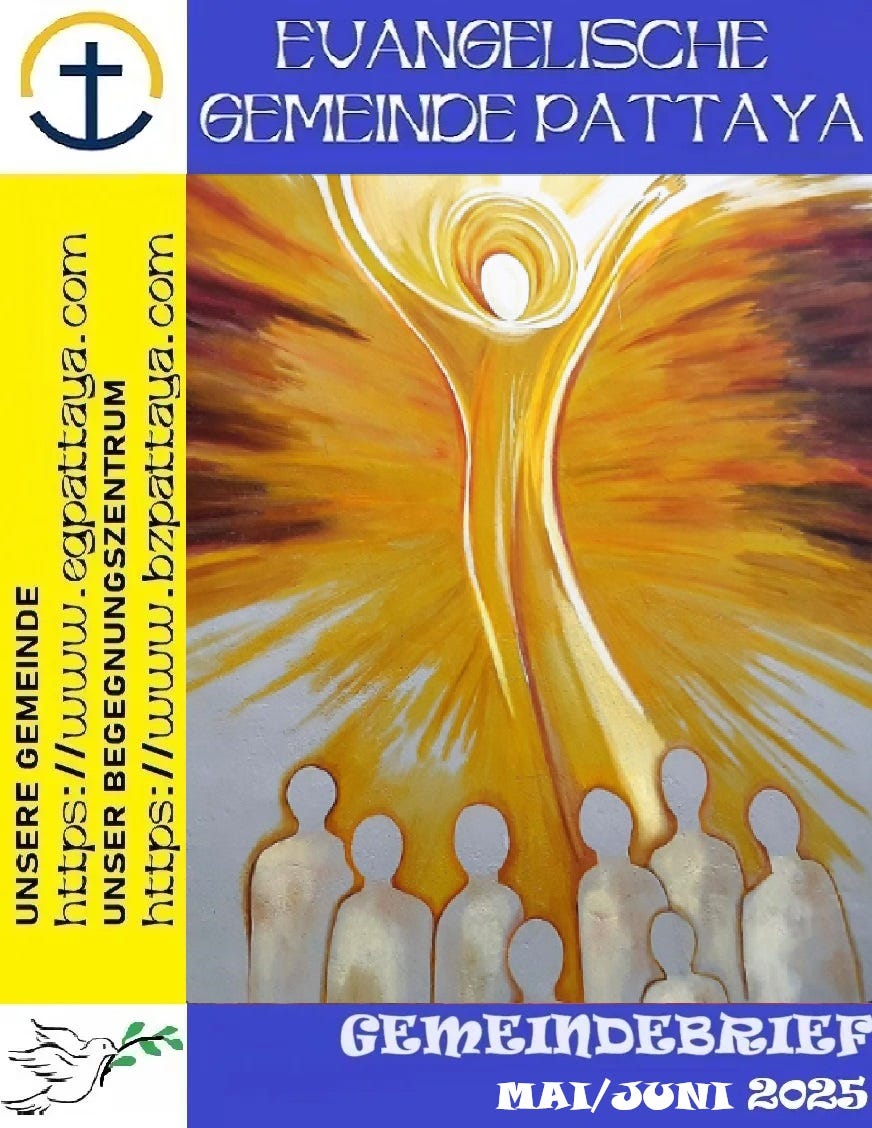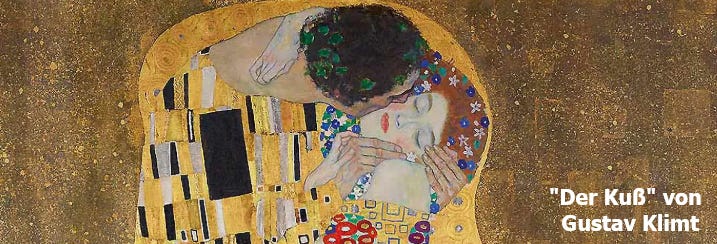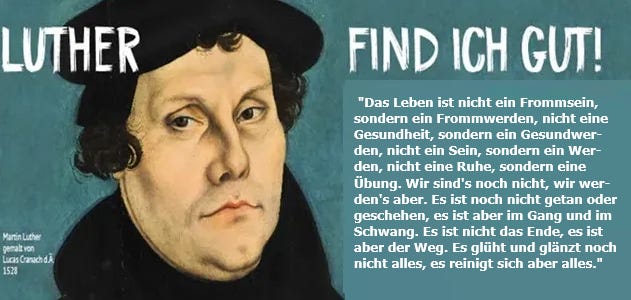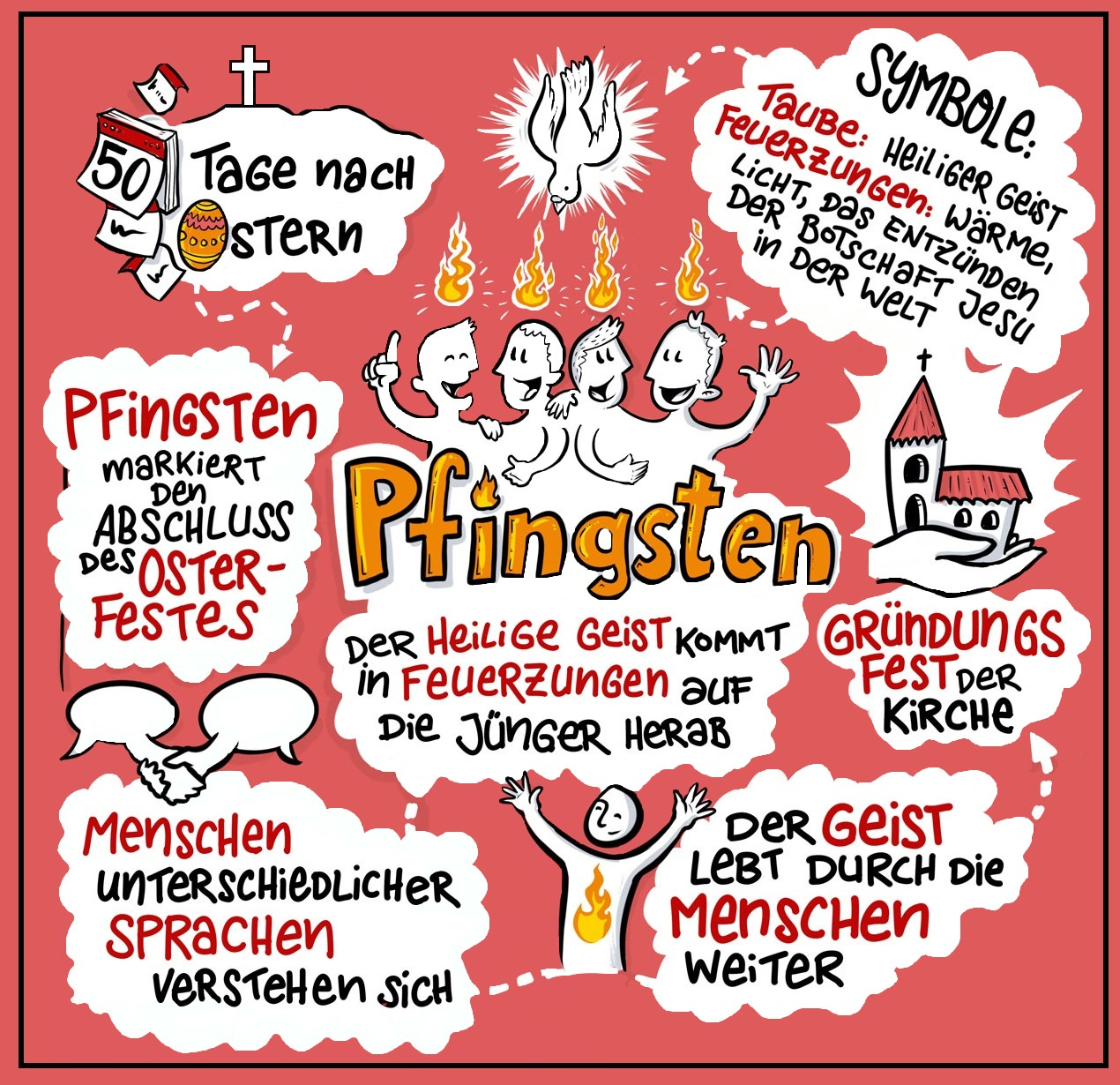Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Pattaya
31.05.2025 Ausgabe 05/06 2025
Liebe Gemeindemitglieder, werte Schwestern und Brüder in Christo,
die Hauptsaison ist vorbei, Pattaya wird zunehmend leerer und begibt sich ein wenig in den “Sommerschlaf”. So sind denn auch zahlreiche Gemeindemitglieder und Besucher des Begegnungszentrums für einen Kurzurlaub oder mehrmonatigen Aufenthalt in die D A CH Region aufgebrochen. Wir wünschen unseren Zugvögeln eine entspannte Heimreise, Gottes reichen Segen für eine gute Zeit daheim und eine gesunde Rückkehr nach Pattaya. Das Begegnungszentrum Pattaya bleibt selbstverständlich durchgehend geöffnet, wenn auch bei etwas reduziertem Programmangebot.
Das gilt auch für unsere Präsenzgottesdienste, die auch in den kommenden Monaten alle 14 Tage stattfinden werden. Hinzu kommt unser neues zusätzliches digitales Angebot der Online-Gottesdienste, die im Wechsel mit denen im BZP ebenfalls alle 14 Tage angeboten werden und auf unserem YouTube Kanal jeweils Sonntags ab 11.00 Uhr abrufbar sind. Die Zugriffszahlen der ersten Online-Gottesdienste waren erfreulich hoch, das motiviert zum Weitermachen!
Ein Höhepunkt im Monat Mai war der Besuch des deutschen Botschafters Dr. Ernst Reichel in Begleitung des Generalskonsuls Rudolf Hofer 28.05. in unserem Begegnungszentrum. Pastor Peter stellte die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates vor und informierte während der Begehung sowohl über die Historie unserer Einrichtung als auch das aktuelle geistliche, kulturelle und sozial-diakonische Angebot unserer nach wie vor komplett ehrenamtlich betriebenen Einrichtung. Bei Kaffee und Kuchen kam es dann zu einem Gedankenaustausch, um die Kommunikation und Kooperation zwischen Botschaft und Begegnungszentrum zu optimieren.
Urlaubs- und ferienbedingt wurde der Beginn des diesjährigen Konfirmandenunterricht der Evangelischen Gemeinde Pattaya auf September verschoben. Es sind noch Plätze frei, interessierten Eltern und ihre Kinder zwischen 12-15 Jahren wenden sich zwecks weiterer Informationen direkt an Pastor Peter unter: pastor.peter@egpattaya.com.
Die Nebensaison ist für die Verantwortlichen keine Zeit in der Hängematte, sondern dient der Vorbereitung der kommenden Saison. So laufen die Planungen für das 2025 erstmalig in Pattaya stattfindende “Fest der Deutschen” am 3. Oktober 2025 sowie der weiteren Events bereits auf Hochtouren. Auch in der Saison 2025/26 wird das Begegnungszentrum seinen Besuchern und unseren Mitgliedern ein buntes Potpourri an Information, geistlicher Begleitung, kulturellen Angeboten und unterhaltsamen abendlichen Events mit viel Spaß und Freude anbieten.
In diesem Sinne, bleibt behütet und stabil,
eure Gemeindebrief-Redaktion
Humor
Der Religionslehrerin will wissen, was sich die Schüler von der letzten Unterrichtsstunde gemerkt haben. Er bittet Fritzchen: „Erzähle uns doch, was du über Moses Herkunft weißt.“ - Fritzchen antwortet: „Seine Mutter war eine Prinzessin in Ägypten!“ Die Lehrerin: „Aber nein, Fritzchen, du hast nicht richtig zugehört - es war die Tochter des Pharao, nicht seine Mutter, die hat ihn beim Baden im Nil in einem Körbchen im Schilf gefunden.“ Fritzchen: „Ja, das hat sie behauptet!“
Aus: IDEA #18, 30.04.2025
Zwischen Geschenk und Gebrochenheit
Sexualität ist beglückend, kann aber auch zutiefst verletzend sein. Die Bibel schweigt zu diesem sensiblen Thema nicht. Sie spricht in Gesetzestexten, Erzählungen und Poesie über Intimität, über Wagnis und Begehren. Prof. Torsten Uhlig, Professor für Altes Testament und Rektor der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg, stellt einige Formen vor, wie Sexualität in der Heiligen Schrift zur Sprache kommt.
Die Bibel ist wie eine Bibliothek. Im Bild gesprochen besteht sie aus einzelnen, ganz verschiedenen Schriften. Sie ist enorm vielfältig, weil das Leben so bunt ist. Besonders greifbar wird diese Vielfalt an Sprache und Ausdrucksmöglichkeiten beim Thema Sexualität. Dabei werden unterschiedliche Facetten unseres Menschseins berührt. Die Bibel vermischt sie nicht. Sie ordnet die Aspekte nicht einer übergeordneten Ideologie unter. Machen wir uns im Folgenden auf eine Entdeckungstour durch biblische Texte – nuanciert, wie Sexualität ist.
Die Sprache der Gebote
Mehrfach begegnet Sexualität uns im Alten Testament in der Sprachform der Gebote in den Gesetzestexten. In den Zeiten des Alten Testaments war die wichtigste Bezugsgröße die Großfamilie. Sie umfasste oft mehrere Generationen, die in einem Haus oder auf einem gemeinsamen Grundstück lebten und arbeiteten. Die maßgebliche Autorität in allen Belangen des Zusammenlebens war der Erstgeborene als Familienoberhaupt. Nicht individuelle Selbstbestimmung jeder einzelnen Person stand an oberster Stelle, sondern die Beziehung zur Großfamilie und ihr Überleben. Viele der alttestamentlichen Gebote zum Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, Männern und Frauen, Verwandten untereinander und auch zur Sexualität dienten vor allem der Sicherung von Nachkommen und damit der Existenz der Familie. Manche Gebote gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Deshalb gibt es etwa auch Regeln für die Söhne im Umgang mit den verschiedenen Frauen ihres Vaters (vgl. 3. Mose, 18+20). Polygamie galt nicht als Ideal, sondern als Reaktion auf Unfruchtbarkeit und hohe Sterblichkeit bei Schwangerschaften. Sie diente dem Erhalt der Familie und damit des Lebens.
Die Gebote sind nicht utopisch. Sie träumen nicht von einer besseren Welt, sondern sollten die Gottesbeziehung in der damaligen Lebenswelt gestalten. Auch die Gebote zu sexuellem Verhalten sind in diesen Kontext gegeben. Sie regeln das Zusammenleben in der damals gängigen Großfamilie auf engstem Raum. Darauf zielen etwa die Verbote von Inzest (vgl. 3. Mose 18,6–18; 5. Mose 27,20–23). Konflikte zwischen Generationen und unklare Verwandtschaftsverhältnisse – und damit Erbfolgestreitigkeiten – mussten vermieden werden. Die Gesetzestexte sollten vor allem das Geschenk des Lebens schützen. Mehrere Sexualtabus sind darauf ausgerichtet (3. Mose 18; 20). Andere Aspekte, die wir (zu Recht) für wesentlich halten, bleiben in den Geboten oft ungenannt – so regelt 5. Mose 22,28–29 lediglich, dass ein Vergewaltiger zur lebenslangen Versorgung der von ihm vergewaltigten Frau verpflichtet ist – die psychischen Verletzungen dabei sind (zunächst) nicht im Blick. Dass eine Vergewaltigung Leben zerstört, bleibt in der Bibel dennoch nicht unbesehen. Dazu später mehr. Die Gebote bewerten nicht, sondern orientieren für das Zusammenleben unter den damaligen Umständen.
Da war auch eine polygame Ehe vorstellbar (vgl. 3. Mose 18). Die patriarchale Familienstruktur galt als gegeben: Eine Frau war definiert über den Mann – als Tochter oder Ehefrau. Das gelegentlich anzutreffende Urteil, die Frau gelte im Alten Testament als „Besitz“ des Mannes (erst des Vaters, dann des Ehemannes), ist freilich überzogen. So ist der „Brautpreis“ kein Kaufpreis, sondern eine Gabe für den Verlust der Arbeitskraft. In Rechtsfällen zu Kindern handeln Vater und Mutter gemeinsam (vgl. 5. Mose 21,18–21; 22,13–17).
Was Jesus wichtig ist
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die alttestamentlichen Gesetze auf die damalige Großfamilienstruktur ausgerichtet waren. Das bedeutet nicht, dass uns diese Gesetzestexte heute nichts mehr zu sagen haben. Ihre Relevanz liegt nicht in der wörtlichen Übertragbarkeit. Wir werden ihnen nicht gerecht, wenn wir nur fragen: „Sollen wir das heute genauso machen oder nicht?“ Ihre Botschaft erschöpft sich nicht in der Frage: „Gilt das auch heute oder nicht?“ Sie sind auch heute zu hören – aber nicht allein. Das wird daran erkennbar, dass Jesus in seinen wenigen Bezugnahmen auf Ehe- und Sexualgebote die Akzente anders setzt (Markus 10,1–12 zur Ehescheidung; Matthäus 5,27–32 zu Ehebruch). Hebt das Alte Testament das Leben in dieser Welt hervor und gibt ihm damit Wert, überschreitet Jesus diese Begrenzung. Mit und durch ihn gibt es Hoffnung auf ein Leben durch den Tod hindurch. Damit aber kann sich die Betonung verlagern von der Beschränkung auf das Leben in der „alten Schöpfung“ und die alleinige Sorge um Leben durch Nachkommenschaft auf die Treue zwischen Mann und Frau. Jesus stärkt die exklusive Beziehung zwischen ihnen und hebt sie über die alttestamentliche Ausrichtung auf Nachkommenschaft. Damit entfaltet Jesus, was im Alten Testament bereits an anderer Stelle über die Beziehung zwischen Mann und Frau angelegt ist.
Die Sprache der Erzählung
Die Erzählung von Adam und Eva im Garten Eden bringt in einzigartiger Weise die Erfahrung von Zweisamkeit, Intimität und Partnerschaft zur Sprache – und zeigt, wie der Bruch mit Gott zu Hierarchie und Misstrauen zwischen Mann und Frau führte (1. Mose 2–3). Damit der Mensch nicht einsam ist (trotz der Gegenwart Gottes im Garten!), erschafft Gott ihm eine Hilfe, wörtlicher „als ihm gegenüber“. Beide leben auf Augenhöhe. Sie vereinigen sich. Sie erkennen, wie gut sie zueinander passen. Doch dann kommt der Bruch mit Gott: Die partnerschaftliche Zweisamkeit wandelt sich zur Hierarchie. Geschenk und Gebrochenheit sind zugleich die Grunderfahrung von Zweisamkeit. Die exklusive Partnerschaft zwischen einem Mann und einer Frau wird gefeiert und in dieser Welt gleichzeitig gestört von Identitätsproblemen, Hierarchie und Machtkämpfen. Das Alte Testament hält beides zusammen: In einer gebrochenen Welt bildeten sich patriarchale Strukturen, in denen das Überleben der Großfamilie geregelt werden muss. Zugleich aber ist immer als Klammer voranzustellen: Die intime Zweisamkeit von Mann und Frau ist das Geschenk, das Gott dem Menschen zu seiner Entfaltung und Schöpfungshinwendung mitgibt. Sie möchte gelebt und in Treue zueinander gestaltet werden – in der ausschließlichen Hingabe an allein eine Person. Der
Apostel Paulus greift die Bedeutung von Intimität in der Treuebeziehung einer Ehe im ersten Korintherbrief (Kapitel 6) auf. Zugleich verweist auch er darauf, dass die Heilszuwendung Gottes im Neuen Testament über das geschöpfliche Leben hinausgeht (Kapitel 7). Beides gilt es in dem christlichen Leben „zwischen den Zeiten“ beieinander zu halten.
Die Sprache der Poesie
Ein biblisches Buch widmet sich ganz der Intimität von Mann und Frau – mit feinem Gespür für Glück, aber auch der Gefährdung und der Macht der Sexualität zwischen Mann und Frau. Wer sich dem alttestamentlichen Buch „Das Hohelied Salomos“ nähert, betritt eine andere Welt und Sprache. Wie Sexualität selbst entzieht es sich klaren Strukturen. Es ist ein poetischer Dialog zwischen zwei Liebenden, begleitet durch Reflexionen einer größeren Schar. Dabei entfaltet es vielschichtig, was es mit Liebe, Sexualität und Zweisamkeit auf sich hat. Vordergründig werden reale Handlungen, Materialien, Orte und Gegenstände beschrieben. Und zugleich werden subtil unterschwellig Gefühle und Verlangen, Erotik und sexuelle Handlungen hörbar – im Hebräischen noch deutlicher, als es deutsche Übersetzungen vermögen. Das Buch entfaltet in poetischen Bildern Sexualität als Gottes Geschenk, das es verantwortungsvoll zu gestalten gilt. Wertvolle Nuancen kommen zur Sprache, die viel zu schnell übersehen werden. So ist in Hohelied 4,1–5,1 eine bemerkenswerte Bewegung wahrzunehmen: Von der Faszination und erweckenden Erregung in der Beschreibung seiner Geliebten kommt der Freund auf das Wagnis und Abenteuer zu sprechen, sich auf die Begegnung einzulassen, die schließlich in der Liebe, Zweisamkeit und Intimität glückt – im „Garten“. Wichtig ist auch, wie die Freundin selbst zu Wort kommt, dem Geliebten ihre Erlaubnis erteilt (4,16), zu ihr zu kommen. Und dann schließt sich ein Redegang der Geliebten an (5,2–6,3). Durchgehend begegnen sich Mann und Frau auf Augenhöhe.
Das Hohelied erinnert daran, dass jede sexuelle Begegnung (auch in der Ehe) ein Wagnis ist – und ein sich Einlassen auf den bzw. die andere. Dies wird in Hohelied 4,13–14 mit den fremden Gewürzen und kaum aussprechbaren Fremdwörtern erfahrbar. Und bei allem sexuellen Glück (5,2–5) ist auch Enttäuschung und Verletzlichkeit nicht fern (5,6–7). Es greift zu kurz, wenn wir sagen: „Am Hohelied sehen wir, dass Sexualität ein Geschenk Gottes ist“. Ja, das ist so. Aber das Hohelied zeigt viel umfassender, wie grandios Sexualität ist, wie enttäuschend sie sein kann, wie verletzlich, welch ein Wagnis damit zusammenhängt.
Sprachlosigkeit überwinden
Sexualität kann also höchst beglückend, aber auch zutiefst verletzend sein. Die Bibel – besonders das Alte Testament – eröffnet dazu wichtige Perspektiven und hilft, Sprachlosigkeit zu überwinden. Ein letztes Beispiel soll das veranschaulichen. In 1. Mose 34 lesen wir von einer schrecklichen Erfahrung, die Dina, die einzige Tochter von Jakob, erleiden musste. Sie wurde vergewaltigt von Sichem, dem Sohn des Königs der gleichnamigen Stadt. Er selbst scheint daran nichts Problematisches zu finden; er gewinnt Dina lieb, möchte sie heiraten. Die Erzählung zeigt die Verblendung des Vergewaltigers (der als Liebe ansieht, was Vergewaltigung ist) und die zerstörerische Dynamik sexualisierter Gewalt. Im weiteren Gang der Erzählung erfahren wir, wie zwei problematische Haltungen auf die Vergewaltigung folgen: Das Familienoberhaupt Jakob tut gar nichts und schweigt, während seine Söhne Levi und Simeon in ungezügelte Gewalt verfallen und aus Rache eine ganze Stadt auslöschen. Dina kommt gar nicht zu Wort. Damit bildet die Erzählung ab, was so vielen Opfern von sexualisierter Gewalt passiert: Sie werden nicht gehört. Die Erzählung bietet keine Lösung, aber sie verschweigt die verletzende Erfahrung sexualisierter Gewalt nicht. Sie zeigt: Gewalt erzeugt neue Gewalt – an Dina, die zunächst im Hause ihres Vergewaltigers bleiben muss, und durch ihre Brüder. Die Geschichte zwingt zur Auseinandersetzung mit der verletzenden Seite sexualisierter Gewalt. Am Ende gibt es nur Opfer.
Ein anvertrauter Schatz
Es gäbe noch so viel mehr aufzuzeigen aus den vielfältigen Sprachformen der Bibel, in denen Sexualität ins Bewusstsein gebracht wird – wie die Schönheit, Verantwortung, Macht und Gestaltungsmöglichkeiten bei Sexualität erschlossen werden. Die vielen Aspekte, die es zu entdecken und zu beachten gilt, kommen in der Bibel in einer großen Breite und Tiefe zur Sprache. Damit ist uns ein Schatz gegeben, durch den wir eine Sprache finden für das Geschenk, die Gebrochenheit, die Leidenschaft und Verletzlichkeit, die in Zweisamkeit und Intimität verantwortlich gestaltet werden können.
Humor
Um die Nachbarskinder vom Klauen der Kirschen im Pfarrgarten abzuhalten, befestigt der Pfarrer ein Schild am Baumstamm. „Gott sieht alles!“ Am Morgen steht darunter zu lesen: „Ja! – aber er verrät nichts!“
Zyperns Weg zum Christentum - Eine Insel wird christlich. 1. Teil
Der heilige Barnabas ist für die Christen Zyperns ein zentraler Bezugspunkt, als sie im 4. und 5. Jh. ihre Identität zu formen beginnen. Die Verehrung einheimischer Bischöfe als Heilige wird zu einem charakteristischen Merkmal – und löst einen regelrechten Wettstreit um die imposantesten und prächtigsten Kirchbauten aus.
Die früheste Erwähnung zur Christianisierung Zyperns begegnet uns schon in der Apostelgeschichte: Sie erzählt, dass Paulus, Barnabas (ein Levit aus Zypern, Apg 4,36) und Johannes Markus (möglicherweise ein Neffe des Barnabas) berufen wurden, das Evangelium nach Zypern zu bringen (13,4–12). Ihre ersten Predigten hielten sie demnach im Jahr 45 in den jüdischen Synagogen von Salamis. Anschließend durchquerten sie die gesamte Insel bis zur Provinzhauptstadt Paphos. Dort kam es in Anwesenheit des verständigen Prokonsuls Sergius Paulus zur Konfrontation zwischen Paulus und dem jüdischen falschen Propheten Elymas/Barjesus, der zum Gefolge des Prokonsuls gehörte. Als Paulus den „Zauberer“ vorübergehend erblinden lässt, kommt Sergius zum Glauben – „voll Staunen über die Lehre des Herrn“. In der Episode in Paphos wird Saulus auch zum ersten Mal Paulus genannt. Sie erzählt von der ersten Verkündigung des Evangeliums an Nichtjuden. Bereits kurz nach der Hinrichtung des Stephanus seien einige „Versprengte“ (11,19) aus Jerusalem nach Zypern gelangt und hätten sich an die dort zahlreich vertretene jüdische Gemeinde gewandt. Andere, darunter einige aus Zypern und Kyrene, die nach Antiochia geflohen waren, begannen, den Griechen zu predigen (11,20). Nachdem sich Barnabas und Paulus getrennt hatten, segelten Barnabas und Johannes Markus laut Apg 15,36–39 im Jahr 48/49 erneut nach Zypern. Ein griechischer Jude namens „Mnason von Zypern“ wird als „Jünger aus der Anfangszeit“ in der Jerusalemer Gemeinde erwähnt (21,15). Doch nach der Apostelgeschichte gibt es eine lange Unterbrechung, bis das Christentum wieder erwähnt wird. In der frühchristlichen Literatur finden sich keine gesicherten Hinweise auf Märtyrer oder vorkonstantinische Bischöfe auf Zypern. Ebenso fehlen sicher datierte christliche Inschriften aus der Zeit vor dem 4. oder 5. Jh.
Während der großen Christenverfolgungen wird Zypern nur ein einziges Mal in kirchlichen Quellen erwähnt: Im Jahr 309/310 informierte der Statthalter von Palästina den Kaiser Maximinus, christliche Gefangene hätten in Kupferminen eigene Kirchen errichtet, weshalb er angeordnet habe, die Gefangenen nach Zypern, in den Libanon und andere Teile Palästinas zu deportieren (Eus. Mart. Pal. 13.2). Mögliche Erklärungen für das Fehlen Zyperns in frühen christlichen Quellen sind, dass die christlichen Gemeinden sehr unauffällig lebten oder einen nicht konfrontativen modus vivendi mit der paganen Bevölkerung gefunden hatten. Nach heutigem Forschungsstand finden sich die frühesten nachgewiesenen Spuren christlicher Architektur in Soloi, der Stadt mit den wertvollsten Kupfervorkommen und dem besten Winterhafen an der gesamten Nordküste Zyperns. Im Osten der antiken Stadt, nahe dem Theater, wurde ein frühchristliches Kultzentrum entdeckt, das älter ist als die monumentalen Basiliken des 5. und 6. Jh., die später an derselben Stelle errichtet wurden. Ein ähnliches Beispiel gibt es in Tamassos, wo an der Stelle des späteren Klosters des heiligen Herakleidios wahrscheinlich bereits eine frühchristliche Kultstätte existierte.
Ab dem 4. Jh. – mit einem Höhepunkt im 6. Jh. – rückte Zypern von der Peripherie im Osten des Römischen Reichs in den Mittelpunkt. Mit der Errichtung der neuen Hauptstadt am Bosporus, Konstantinopel, verlagerte sich militärische und wirtschaftliche Macht in den Osten. Für die Insel bedeutete das: wirtschaftlicher Aufschwung und Wachstum der Städte. Salamis wurde zur Provinzhauptstadt Zyperns und erhielt den neuen kaiserlichen Namen Constantia. Die Erdbeben des 4. Jh. führten wahrscheinlich – wie auch anderswo – dazu, dass die letzten intakten paganen Kultstätten endgültig aufgegeben wurden. Es ist jedoch äußerst schwierig, ein Gefühl für das Ausmaß der Erhaltung, Zerstörung oder das Verfallen-Lassen der paganen Heiligtümer Zyperns zu bekommen, da uns Befunde für diese Prozesse fehlen. Das berühmte Aphrodite-Heiligtum in Paphos scheint die Erdbeben des 4. Jh. nicht überstanden zu haben, während das Heiligtum des Zeus Olympios in Salamis vermutlich kurz danach aufgegeben wurde.
Theater, Bäder, Stadtpaläste und Arenen wurden dagegen planmäßig instand gesetzt. Von spektakulären Gewalttaten gegen Heiden und ihre Tempelberichten unsere Quellen nichts. Einige hagiografische Texte erwähnen gelegentliche Konflikte und ikonoklastische Gewaltakte zwischen Christen und Heiden in den Städten Zyperns, doch ist es schwierig, aus diesen Erzählungen einen historischen Kern herauszufiltern.
Zeugnisse des Übergangs
Mehrere Weiheinschriften an Theos Hypsistos („Höchster Gott“), die traditionell ins 3. Jh. datiert werden, weisen auf synkretistische religiöse Muster auf Zypern hin. Diese Inschriften stehen in Verbindung mit einer judaisierenden paganen Gruppe („die Hypsistarier“), die den Höchsten Gott verehrte und auch aus anderen Teilen des Reiches bekannt ist. Im 4. Jh. schrumpfte diese Gruppe jedoch allmählich zu einer Randsekte. Wie dem auch sei, es ist unwahrscheinlich, dass die lokale Bevölkerung Zyperns vor der Mitte des 4. Jh. in großer Zahl zum Christentum übertrat. Die Mosaikinschriften des Eustolios-Komplexes in Kourion (vgl. WUB 1/2025, S. 70–71) werden oft als Schlüsselbelege für den religiösen Wandel im spätantiken Zypern herangezogen. Eustolios errichtete für die Stadt Kourion einen Bade- und Empfangskomplex: „Eustolios hat gesehen, dass die Bewohner von Kourion, die vormals sehr wohlhabend waren, in ernsthafte Not geraten waren. Er hat die Stadt seiner Väter nicht vergessen und ließ diese Bäder für die Stadt errichten. Er sorgte für Kourion, wie es einstmals Phoibos (Apoll) tat und baute dieses windgeschützte Refugium.“ Die Inschriften stammen aus den ersten Jahrzehnten des 5. Jh. und betonen den christlichen Glauben, die klassische Paideia („Bildung“), und zeigen, wie sich die aristokratischen Werte einer angesehenen lokalen Familie wandelten. Sie zeigen schöne Vignetten des christlichen Klassizismus in Sprache und Rhetorik. Hier zeigt sich keine religiöse Feindseligkeit – die mythologische Vergangenheit der Stadt, deren Hauptheiligtum dem Apollo Hylates („der Wälder“) geweiht war, wird vielmehr aufgegriffen, um die Tugenden des Eustolios zu preisen.
In einer weiteren Inschrift lesen wir: „Anstelle von großen Steinen und festem Eisen, anstelle von glänzender Bronze und Diamant, ist dieses Haus umgürtet von den viel verehrten Symbolen Christi.“ Die Erwähnung von Steinen, Eisen, Bronze und Stahl könnte sich auf den früheren Reichtum der paganen Tempel und ihrer Opfergaben in Kourion beziehen. Dies würde im Gegensatz zu einer neuen Form der christlichen Wohltätigkeit stehen, die Eustolios förderte. Die „Symbole Christi“ beziehen sich vermutlich auf ein verloren gegangenes Dekorationsprogramm. Eine weitere Mosaikinschrift erwähnt die Tugenden Aidos (Ehrfurcht), Sophrosyne (Mäßigung) und eine dritte, die heute nicht mehr lesbar ist. Sie alle hüten „die Exedra und diese duftende innere Halle“. Diese Tugenden lassen sich noch als traditionelle aristokratische Werte verstehen, ohne offensichtliche dogmatische Bezüge – möglicherweise waren sie an weibliche Besucherinnen dieser Halle gerichtet.
TEIL 2 FOLGT IN DER KOMMENDEN AUSGABE
[Prof. Dr. Georgios Deligiannakis lehrt an der Open University of Cyprus römische und spätantike Geschichte]
Unsere ONLINE und Präsenz-Gottesdienste im Juni 2025