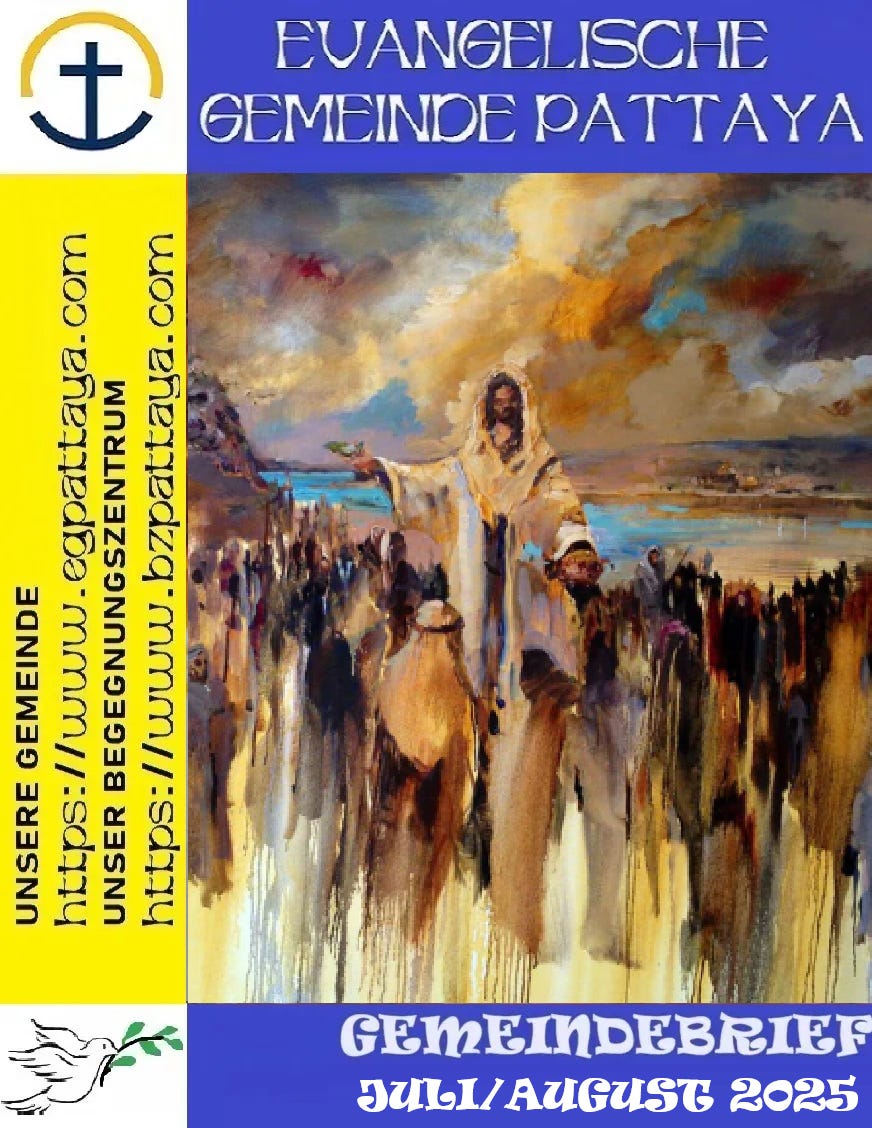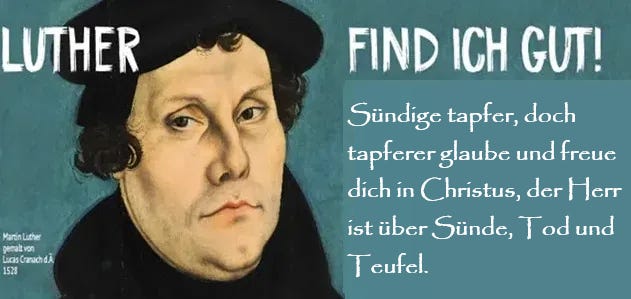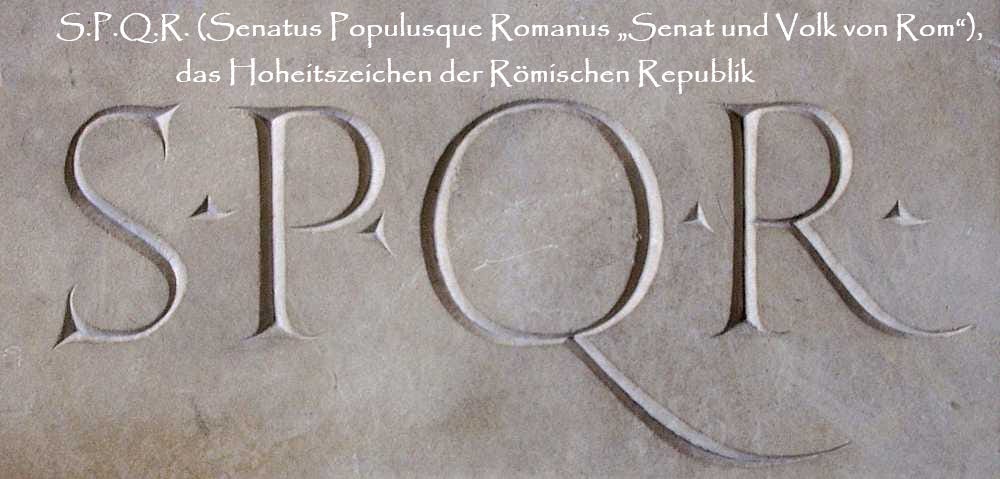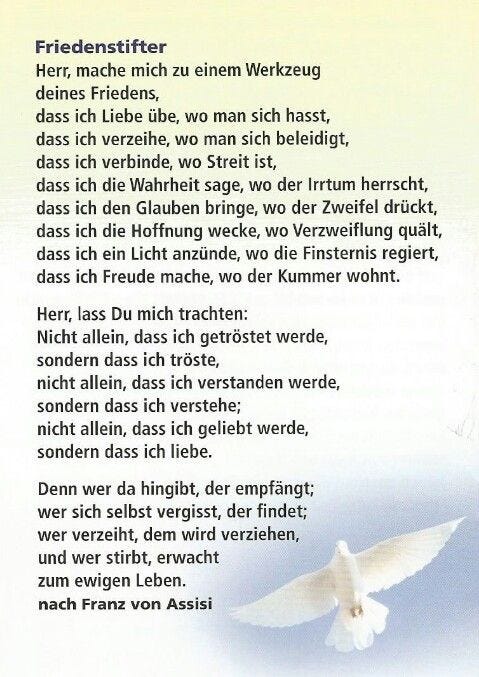Gemeindebrief der Evangelischen Gemeinde Pattaya
31.07.2025 Ausgabe 07/08 2025
Liebe Gemeindemitglieder, werte Schwestern und Brüder in Christo,
auch in Pattaya sind mittlerweile die Auswirkungen der Nebensaison zu spüren: deutlich weniger ausländische Touristen, während der Inlandstourismus zumindest an den Wochenenden im Seebad kaum abgenommen hat, was die Bangkoker Nummernschilder ab Freitag Mittag hinreichend belegen. Des einen Freud, des anderen Leid. Während sich die “Eingeborenen” über weniger Stress, teils niedrigere Preise in den Restaurants und mehr Chancen auf eine Parkmöglichkeit freuen, klagen die auf Auslandstouristen angewiesenen Unternehmer über geringere Umsätze.
Auch im Begegnungszentrum geht es traditionell im Juli und August ruhiger zu, viele unserer “Zugvögel” sind zeitweilig unter dem Motto »Urlaub vom Urlaub« in die D A CH-Region gereist. Die meisten haben aber ihren Rückflug bereits gebucht und erfahrungsgemäß geht es ab September wieder richtig los. Natürlich ist das BZP auch in dieser Zeit geöffnet, wenngleich mit reduziertem Programmangebot.
Ein Höhepunkt in der “staden Zeit” war sicherlich der Besuch des deutschen Botschafters Dr. Ernst Reichel in Begleitung des Generalskonsuls Rudolf Hofer am 28.05. in unserem Begegnungszentrum.
Darüber berichtete der FARANG wie folgt: “Ein weiterer zentraler Programmpunkt war der Besuch des Begegnungszentrums Pattaya (BZ), einer in der deutschsprachigen Community fest verankerten Einrichtung, die soziale, kulturelle und seelsorgerische Angebote für Residenten und Langzeiturlauber bereithält. Botschafter Dr. Reichel wurde dort von Geschäftsführer Pastor Peter Hirsekorn herzlich empfangen und durch die Räumlichkeiten geführt. Neben dem beliebten Café besichtigte die Delegation auch die hauseigene Bibliothek mit mehreren tausend deutschsprachigen Büchern, die allen Besuchern kostenlos zur Verfügung stehen.
Im Anschluss nahm der Botschafter an einer Gesprächsrunde im klimatisierten Gottesdienstraum teil, bei der er sich den Fragen des Vorstandes stellte. Diskutiert wurden unter anderem Themen wie die soziale Absicherung älterer oder hilfsbedürftiger Deutscher, Schwierigkeiten mit Krankenversicherungen und und Visaverlängerungen sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Vereinsarbeit in Thailand. Pastor Hirsekorn erläuterte die Herausforderungen, denen sich das Begegnungszentrum als eingetragener thailändischer Verein stellen muss – etwa bei der Mittelbeschaffung und behördlichen Anerkennung.
„Ich möchte nicht nur die offizielle Perspektive kennenlernen, sondern auch hören, was die Menschen vor Ort bewegt – direkt von jenen, die täglich mit ihren Sorgen, Fragen und Nöten zu tun haben“, betonte Reichel. Der Austausch verlief in offener und konstruktiver Atmosphäre und wurde von beiden Seiten als äußerst wertvoll gewertet.”
Nach erfolgter Taufe konnten wir ein weiteres thailändisches Mitglied in unsere ständig wachsende Gemeinde aufnehmen: herzlich Willkommen liebe Tadpicha “Anne” Wathanachinda.
Am 27.07. läuteten dann erneut die Hochzeitsglocken im Begegnungszentrum, als sich Heinz Jürgen Bernewski und Anne Wathanachinda das Ja-Wort gaben. Beim anschließenden, vom Brautpaar gesponserten, Kuchenbuffet und dem traditionellen Kirchenkaffee nahmen die frisch Vermählten zahlreiche Glück- und Segenswünsche der anwesenden Besucher und Gemeindemitglieder entgegen.
Im September beginnt dann der Konfirmandenunterricht im Begegnungszentrum, der ca. Jahr dauern wird und im Herbst 2026 mit der Konfirmation der Teilnehmer abgeschlossen wird. Angemeldet haben sich bereits Helen und Adrian, weitere Anmeldungen nimmt Pastor Peter gerne unter: pastor.peter@egpattaya.com bzw. 0960746695 entgegen, der auch für ein Informationsgespräch vorab nach Absprache zur Verfügung steht.
Last but not least sei noch darauf hingewiesen, das sich unserer Kreativteam am 23.08.205 zum gemeinsamen Helferfrühstück treffen wird (Einladungen gehen rechtzeitig per E-Mail zu), um danach im Begegnungszentrum letzte Hand an die organisatorischen Vorbereitung der Saison 2025/26 zu legen. Neben unseren Klassikern wie Oktoberfest, Kessel Buntes, Weihnachtsfeier, Karneval und Oldie Night werden wir am 3. Oktober beispielsweise erstmals das “Fest der Deutschen” in Pattaya feiern, weitere Infos folgen in Kürze.
Bis dahin wünschen wir allen Lesern einen schönen Monat August, unseren Zugvögeln eine gesunde und stressfreie Rückkehr nach Thailand und unseren Gasten, Besuchern und Gemeindemitgliedern Gottes reichen Segen auf all euren Wegen.
Herzliche Grüße, Pastor Peter Hirsekorn
„Ich halte mich nach wie vor für unschuldig”
Nach den Gerichtsprozessen wegen Volksverhetzung und der Verhängung einer Disziplinarstrafe äußert sich der Bremer Pastor Olaf Latzel erstmals in einem Interview. IDEA-Reporter Karsten Huhn sprach mit ihm über die Kritik an seinen Äußerungen, die Gehaltskürzung und über die Qualitätskontrolle seiner Predigten. [IDEA DAS CHRISTLICHE SPEKTRUM 31/32.2025]
IDEA: Herr Latzel, die Bremische Evangelische Kirche hat als Disziplinarmaßnahme Ihr Gehalt gekürzt – um fünf Prozent für die Dauer von vier Jahren. Wie predigt es sich auf Bewährung?
Latzel: Ich bin dankbar, dass ich das Wort Gottes weitergeben darf. Die Umstände sind dabei für mich nachrangig – ob ich nun krank bin oder Stress mit meiner Frau habe oder es irgendwelche anderweitigen Auseinandersetzungen gibt. Ich will mir die Freude über das Evangelium nicht nehmen lassen und einfach weiter fröhlich von Jesus Christus erzählen.
Die Gehaltskürzung soll „als Erinnerung und Mahnung für sein Fehlverhalten dienen“, heißt es zur Begründung. Fühlen Sie sich erinnert und gemahnt, wenn Sie auf Ihre monatliche Gehaltsabrechnung schauen?
Latzel: Ich habe mich jetzt fünf Jahre mit dem Thema auseinandersetzen dürfen. Natürlich ist das etwas, was mit mir geht. Aber mein Blick geht immer ans Kreuz zu Jesus Christus. Die Gehaltskürzung spielt für mich letztlich keine Rolle.
Ihre Gemeinde hat gegen die Disziplinarmaßnahme protestiert. Die Kirchenleitung habe „mehrfach sowohl das Disziplinar- und Kirchenrecht als auch die Sorgfaltspflicht gegenüber Latzel verletzt“ und eine „unbarmherzige und rücksichtslose Haltung“ gegenüber den Mitgliedern der St.-Martini-Gemeinde gezeigt.
Latzel: Ich bin natürlich dankbar für die Rückendeckung, die ich in den letzten Jahren durch die Gemeinde erlebt habe. Auch für die Solidarität und die Gebete von den vielen Menschen aus unserer Internetgemeinde, die ich gar nicht persönlich kenne. Und mit dem, was ich mit meinem Arbeitgeber zu klären habe, gehe ich nicht an die Öffentlichkeit.
Gab es eine Reaktion der Landeskirche auf die Kritik Ihrer Gemeinde?
Latzel: Soweit ich weiß: nein.
Bremen ist überschaubar groß, man begegnet sich durchaus mal auf dem Marktplatz.
Latzel: Also ich kann den Menschen in der Kirchenleitung ganz unbenommen und freundlich begegnen. Ich wohne aber außerhalb von Bremen, komme zum Arbeiten in die Stadt und halte mich sonst nicht so häufig in der Stadt auf. Ich bin nicht so der Stadtmensch, ich bin der Pastor aus der Provinz. Das habe ich der Gemeinde vor meinem Amtsantritt auch so gesagt. Von daher ergeben sich nicht so viele Begegnungen.
Sie waren ein halbes Jahr vom Dienst suspendiert.
Latzel: Dazu kamen der Umbau der Kirche und die Corona-Pandemie – und auf einmal war der Pastor nicht mehr da. Aber unsere Gemeinde ist keine Olaf-Latzel-Gemeinde, keine One-Man-Show, sondern die Brüder und Schwestern haben das in wunderbarer Weise auch ohne mich hingekriegt. Das Priestertum aller Gläubigen funktioniert.
Sie haben sich einen gewissen Ruf erarbeitet. Die „tageszeitung“ nannte Sie einen „queerfeindlichen Hassprediger“, die „Hannoversche Allgemeine“ „Pastor Lieblos“ und die Bremer Fernsehsendung „buten und binnen“ bezeichnete Sie als „evangelikalen Pastor mit bekannt wenig ausgeprägter Affektkontrolle“.
Latzel: Es steht jedem frei, mich und meinen Dienst zu beurteilen. Entscheidend ist für mich, was eines Tages mein Herr und Heiland Jesus Christus über meinen Dienst sagt. Da werde ich nicht bestehen können. Ich werde vor ihm stehen, und er wird mir sagen: „Du bist faul gewesen, du bist lieblos gewesen, du bist schuldig geworden.“ Und ich werde auf tausend Dinge, die mir der Herr vorhalten wird, immer nur sagen können: „Ja, das stimmt.“ Aber Gott sei Dank hat Jesus mit seinem Blut für meine Schuld und Sünde bezahlt. Ich versuche, zur Ehre Jesu Christi zu leben, aber ich will überhaupt nicht abstreiten, dass Dinge in meinem Leben nicht richtig sind. Ich bin und bleibe Sünder. Und wenn ich Fehler gemacht und Leute verletzt haben sollte, tut mir das aufrichtig leid. Das habe ich auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Aber ich weiß auch, dass die bibeltreue Verkündigung des Evangeliums unvermeidlich Kritik hervorruft. Dieser Konfrontation gehe ich nicht aus dem Weg. Ich habe gerade über Johannes den Täufer gepredigt. Der hatte den Ehebruch von König Herodes kritisiert. Johannes der Täufer wurde gefangen genommen, und eine Intrige von Herodes’ Frau kostete ihn schließlich den Kopf. Bibeltreue Verkündigung führt zu Widerstand in der Gesellschaft – und zum Teil auch in der Kirche.
War es eine Intrige gegen Sie, dass Ihre Worte aus einem Eheseminar zu einer Anklage wegen Volksverhetzung führten?
Latzel: Dazu will ich keine Verschwörungstheorie aufstellen. Ich habe meinen Anteil daran und bin dafür von meiner Kirche sanktioniert worden. Das habe ich zu tragen.
Sind Sie zu Recht bestraft worden?
Latzel: Ich halte mich nach wie vor für unschuldig. Ich habe mich für meine Wortwahl entschuldigt, aber der Vorwurf der Volksverhetzung trifft nicht zu. Das Gericht hat das Verfahren ja auch eingestellt. Die Kirche hat mich für etwas sanktioniert, das nicht in meiner Absicht stand.
Was ist die Unterstellung, die Sie ärgert?
Latzel: Ich habe in diesem Eheseminar in einem Kontext gesprochen, in dem allen Teilnehmern klar war, dass sich das Wort „Verbrecher“ auf Leute bezog, die unsere Kirche beschmiert haben und die Gottesdienste gestört haben, also Sachen, die strafrechtlich relevant waren. Zudem war dieses Eheseminar nicht für die Verbreitung in der Öffentlichkeit gedacht, sondern nur für die Gemeinde. Ich denke nicht, dass alle Homosexuellen Verbrecher sind. Zu unserer Gemeinde zählen Homosexuelle, das ist überhaupt kein Problem.
Es gab im Eheseminar zwei weitere anstößige Sätze. Sie sagten: „Der ganze Genderdreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, ist zutiefst teuflisch und satanisch.“ Und Homosexualität gehöre zu den „Degenerationsformen der Gesellschaft“.
Latzel: Ein vom Bremer Landesgericht beauftragtes Gutachten sagt, dass alle Dinge, die ich in diesem Vortrag gesagt habe, von der Bibel gedeckt seien. Wenn man diese dann jedoch aus dem Zusammenhang reißt und missverständlich deutet, dann wird das zum Problem.
Würden Sie diese Sätze wiederholen?
Latzel: Ich würde sie nicht mehr so wiederholen, weil ich um die Missverständlichkeit weiß. Die klare Trennung zwischen Sünder und Sünde ist mir nicht gelungen. Als die Kritik am Eheseminar hochkam, habe ich das Video ja auch sofort aus dem Netz nehmen lassen – noch bevor es eine Anklage gab. Es lag nicht in meiner Absicht, Leute zu verletzen oder in irgendeiner Form hetzend zu wirken.
Ich musste während des Gerichtsverfahrens gegen Sie an zwei Bibelworte denken. In Lukas 12,2–3 heißt es: „Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis sagt, das wird man im Licht hören und was ihr ins Ohr flüstert in den Kammern, wird man auf den Dächern verkündigen.“
Latzel: Ich habe nichts im Finstern gesagt, sondern in einem geschlossenen Kreis. Als Journalist führen Sie auch Hintergrundgespräche, deren Inhalte nicht öffentlich werden. Das ist ganz selbstverständlich. Im Bundestag wird in einer Fraktionssitzung auch anders gesprochen als im Plenum. Und wenn wir im Kirchenvorstand Probleme in der Gemeinde besprechen, überlegen wir uns gut, wie wir das an die Gemeinde weitergeben. Es kommt immer auf die Redesituationen und den Adressatenkreis an.
Das zweite Bibelwort lautet: „Wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über“ (Matthäus 12,34).
Latzel: Mein Herz ist hoffentlich voll biblischer Wahrheit. Und die Bibel verurteilt nun mal praktizierte Homosexualität. Das ist auch eine Frage an unsere Gesellschaft: Darf biblische Wahrheit noch ausgesprochen werden?
Haben Sie eine Qualitätskontrolle für sich eingeführt, damit Sie keinen Unsinn predigen?
Latzel: Meine Qualitätskontrolle ist der Heilige Geist. Bevor ich predige, bete ich, dass der Geist mich leitet. Ich schaue natürlich heute auch noch mal sensibler hin, wie die Dinge wahrgenommen werden können. Da habe ich in den letzten Jahren auch dazugelernt. Ich will nicht sagen, dass ich blauäugig war, was das Internet im Positiven wie im Negativen bewirken kann. Dennoch habe ich es unterschätzt.
Die St.-Martini-Gemeinde hat auf YouTube 67.000 Abonnenten – mehr als jede andere landeskirchliche Gemeinde.
Latzel: Mit dieser großen Zuschauerzahl bin ich natürlich noch mehr in der Verantwortung, als wenn ich in einer Dorfgemeinde vor 30 Zuhörern ohne Live-Übertragung predige.
Welche Erklärung haben Sie für die hohe Nachfrage?
Latzel: Viele Klicks zu erzielen ist ein rein weltlicher Erfolg. Erfolgreich ist eine Predigt nur dann, wenn der Herr Vollmacht schenkt. Dann kann auch eine Predigt in einer kleinen Dorfkirche ein geistlicher Erfolg sein. Als Gemeinde versuchen wir, klar bei der Bibel als irrtumsloses Wort Gottes zu bleiben. Nur wer diese Überzeugung teilt, kann bei uns auf der Kanzel stehen.
Haben Sie mehr Fans oder mehr Feinde?
Latzel: Ich brauche keine Fans, und ich will auch keine Feinde. Was ich will, ist Jesus dienen. Und wenn ich das Evangelium verkündige, wird es sowohl Zustimmung als auch Ablehnung geben.
Es gibt offensichtlich Leute, die Ihre Predigten sehr aufmerksam hören und darauf abklopfen, ob etwas Verfängliches dabei ist.
Latzel: Wenn es solche Menschen gibt, hoffe ich, dass der Geist Gottes sie erreicht. Das ist übrigens auch etwas, was ich lernen musste. Als Theologiestudent bin ich in viele Predigten reingegangen und habe darauf geachtet, was in der Predigt nicht richtig ist. Hinterher bin ich zum Pfarrer gegangen und habe ihm seine Fehler erklärt.
Das klingt unsympathisch.
Latzel: Theologiestudenten denken eben häufig, sie hätten alle Erkenntnis dieser Welt. Wenn ich heute in einen Gottesdienst gehe, bitte ich Gott, dass er für mich etwas bereithält. Auch in Predigten, wo man vielleicht denkt, „Na ja, das war es jetzt nicht ganz so“, fällt trotzdem dieser eine Satz, in dem Gott zu einem spricht. Aber ich protestiere auch, wenn etwas Falsches gepredigt wird. Das ist die Aufgabe eines jeden Protestanten.
Werden Sie künftig Bibelstellen meiden, die Homosexualität zum Thema haben?
Latzel: Das kann ich nicht. Die Bibel sagt: Wir sollen dem Wort Gottes nichts dazutun und nichts davon wegnehmen (5. Mose 4,2).
2015 standen Sie schon einmal in der Kritik. Sie bezeichneten Buddha als „alten, fetten Mann“ und das islamische Zuckerfest als „Blödsinn“. Der damalige Schriftführer der Bremischen Kirche warf Ihnen „geistige Brandstiftung“ vor. Ist künftig mit einem weiteren Latzel-Skandal zu rechnen?
Latzel: Es ist ja nicht so, dass ich das plane. Ich versuche, in Treue meinen Dienst für meinen Heiland Jesus Christus zu tun. Die letzten Jahre waren hart, und ich bin sehr darauf bedacht, dass ich keinen Fehler mache oder mir eine Unachtsamkeit leiste.
Was haben Sie aus den letzten Jahren gelernt?
Latzel: Dass wir einen großen Gott in Jesus Christus haben, dass er Zuflucht, Hilfe und Stärke ist. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, darf ich mich bei ihm bergen. Jesus ist da, Jesus hilft. Das ist eine Wahrheit, die ich auch schon vorher kannte, aber sie ist mir in ihrer existenziellen Tiefe noch einmal in ganz anderer Weise deutlich geworden.
Und was haben Sie über sich selbst gelernt?
Latzel: Ich bin ein unbedeutendes Nichts, und Jesus ist alles. Unser Leben ist schnell vorbei, und in der Ewigkeit spielt vieles, über das wir jetzt gesprochen haben, keine Rolle mehr. Je weniger wichtig wir uns nehmen und uns stattdessen auf Jesus fokussieren, umso besser.
[Olaf Latzel (57) ist seit 2007 Pastor der Bremer St.-Martini-Gemeinde. Zuvor war er Pastor der Siegener Stadtteile Trupbach und Seelbach. Latzel ist verheiratet und Vater einer erwachsenen Tochter.]
Humor 1
Ein Rabbi betet zu Gott: "Lieber Gott, mein Sohn ist Christ geworden!"
Gott: "Ja und, meiner auch!"
Rabbi: "Und was hast du gemacht?"
Gott: "Ein Neues Testament geschrieben!"
Humor 2
Pfarrer zum Rabbi: "Habt Ihr schon einmal Schweinefleisch gegessen?" Der Rabbi zögernd: "Ja, einmal während des Studiums, aus reiner Neugier. Und habe Ihr schon einmal mit einer Frau geschlafen?" Der Pfarrer entrüstet: "Nein, niemals!" Der Rabbi: "Im Vertrauen, beides ausprobiert, kein Vergleich."
„Wenn einer dich zwingt …“ (Mt 5,41)
Palästina zur Zeit Jesu unter römischer Besatzung
Wie wurde die römische Besatzung zur Zeit Jesu wahrgenommen? Für viele war sie eine religiöse und politische Katastrophe, für manche dagegen eine Möglichkeit, sich wirtschaftlich und kulturell zu entwickeln. Die unterschiedlichen politischen, religiösen und sozialen Haltungen spiegeln sich auch in den Evangelien.
Viele kennen die berühmte Szene aus Monty Python's Life of Brian (1979): In einem dunklen Hinterzimmer eines Hauses im römisch besetzten Jerusalem trifft sich die „Volksfront von Judäa“ zur Lagebesprechung, um einen Anschlag vorzubereiten. Ziel sind die Römer und ihr „imperialistischer Staatsapparat“, der angesichts all der Verbrechen gegen die jüdischen Väter und deren Väter endgültig aus dem Land gejagt werden soll. Als der Anführer angesichts der römischen Unterdrückung empört fragt: „Was aber haben die Römer dafür als Gegenleistung erbracht?“, folgt zunächst betretenes Schweigen, dann aber zählen die Mitglieder nach ein wenig Nachdenken Stück für Stück all die Segnungen römischer Zivilisation auf, die wir noch heute im Urlaub und in Museen bewundern: „den Aquädukt, die sanitären Einrichtungen, und die schönen Straßen, medizinische Versorgung, das Schulwesen, und den Wein, die öffentlichen Bäder, sichere Straßen“. Als der Anführer etwas ratlos ein letztes Mal fragt, „Abgesehen von all diesen Dingen: Was haben die Römer je für uns getan?“, bekommt er die zögerliche, aber vielsagende Antwort: „Sie haben uns den Frieden gebracht!“
Rom bringt den Frieden, Roms Besatzung ist ein Segen für alle – so sahen es die Römer, aber wohl nicht nur sie. „Römische Besatzung“ ist höchst vielschichtig. Zum einen bot sie Angehörigen der einheimischen Oberschichten ungeahnte Möglichkeiten, ihre Elitestellung nun unter römischer Oberhoheit zu festigen und „als Römer“ Karriere zu machen, indem man sich in lokale und regionale Herrschaftsinstrumente einbinden ließ und die Loyalität zu Rom auch öffentlich zeigte. Im Reich Herodes des Großen und seiner Nachfolger war das nicht anders. Römische Besatzung verteilt Chancen und Reichtum unter den Einheimischen neu und fordert dazu heraus, Stellung zu beziehen. Ideologische und soziale Gegensätze werden vertieft, Positionen profiliert. Wer nicht für Rom ist, ist gegen Rom.
Äußere wie innere Emigration oder Steuerverweigerung sind ebenso Ausdruck von Renitenz wie der blutige Kleinkrieg, den judäische sicarii „Dolchmänner“) gegen vermeintliche Kollaborateure im eigenen Volk führten. Auf längere Sicht aber führte römische Besatzung zur Transformation, in der römische und einheimische Kultur eine einzigartige Symbiose eingingen, die wir „Romanisierung“ nennen. Wer die Lobrede auf Rom des griechischen Schriftstellers Aelius Aristides (2. Jh nC) liest, begreift etwas vom Stolz der Träger und Nutznießer dieser Integration. Als Kontrastpropramm lese man dann aber auch die auf Rom gemünzte Klage vom Fall der „Hure Babylon“ in Offb 18, die Rede des Calgacus in Tacitus' Agricola 30-32 oder von El’azar Ben-Ya’ir in Josephus, Bellum 7,323-336.
Das idealistische Ziel: dem Frieden sittlichen Gehalt geben
Die Römer waren von ihrer Friedensmission fest überzeugt. Keiner drückte diese Haltung mit wirkmächtigeren Worten aus als Vergilius. Im sechsten Buch der Aeneis spricht der greise Anchises folgende prophetische Worte: „Andere werden geschickter zu atmen scheinendes Erz bilden – glaube ich zumindest – und lebendige Antlitze aus dem Marmor formen, Rechtsfälle besser führen, die Bahnen des Himmels in ihrem Lauf beschreiben und die aufgehenden Gestirne benennen. Du, Römer, vergiss nie und denke daran, durch deine Herrschaft die Völker zu lenken. Diese werden deine Fähigkeiten sein: dem Frieden sittlichen Gehalt zu geben, die Unterworfenen zu schonen und die Hochmütigen niederzukämpfen“ (Vergil, Aeneis 6,847-853).
Römische Herrschaft hat immer auch eine religiöse Komponente (Pax war eben auch eine Göttin!), genauso wie auch der Widerstand gegen sie nicht allein Ausdruck verquerer Vermessenheit politischer Wirrköpfe ist, sondern auch religiös konnotiert war: Wer Roms Herrschaft herausfordert, beleidigt Roms Götter und tritt ihre Segnungen in den Staub. Für die Uneinsichtigen hält Roms Friede daher stets das Schwert bereit. Wer aber Roms Machtanspruch akzeptiert, wird in geradezu paradiesischem Frieden und Wohlstand leben, so wie es das berühmte Relief von Mutter Erde (tellus) auf der Ara Pacis in Rom zeigt, die der Senat 13 vC dem eben erst von der „Befriedung“ des unruhigen Spanien und Gallien zurückgekehrten Augustus errichten ließ. Nur Naivlinge würden hierin einen Widerspruch sehen!
Das römisch besetzte Palästina
Das antike Palästina war Teil der sonnendurchfluteten und zugleich blutgetränkten Welt um das Mittelmeer, das römische Legionen seit dem Ersten Punischen Krieg (264–241 vC) Stück für Stück erobert und besetzt hatten und durch Beamte vermessen, verteilen, verwalten und besteuern ließen. Und da das antike Palästina des frühen 1. Jh. nC auch die Heimat Jesu war, sehen wir römische Besatzung vor allem in den Berichten gespiegelt, die das Leben und Sterben des apokalyptischen Reich-Gottes-Predigers aus Nazaret beschreiben, unseren Evangelien.
Sie lassen noch etwas von der Parteilichkeit Jesu erkennen: das „Reich der Himmel“ (so bei Mt) stellte die Machtfrage auch auf Erden! Pilatus hat das wohl genauso gespürt (titulus INRI) wie etwa Lukas, der nicht ohne Ironie die himmlischen Heerscharen bei der Geburt des Messias dem wahren Herrscher im Himmel huldigen lässt, während die Beamten des Augustus auf Erden die Steuern einziehen (Lk 1–2). Römische Besatzung ist für beide, römische Besatzer wie auch jüdische Besetzte, ohne die himmlische Welt nicht zu denken.
Und in Galiläa?
Wie aber sah römische Besatzung im antiken Palästina konkret aus? Die Quellen ergeben ein durchaus komplexes Bild. Grundsätzlich wichtig ist ein Unterschied: Galiläa, wo Jesus zunächst auftrat und seine Anhängerschaft sammelte, stand (noch) nicht unter direkter römischer Kontrolle. Galiläa wurde seit dem Tod des Herodes 4 vC von dessen Sohn Herodes Antipas verwaltet (4 vC–ca. 39 nC). Obwohl auch Antipas auf das Wohlwollen des Kaisers angewiesen war und sich loyal verhalten und für Sicherheit und Stabilität in seinem Fürstentum sorgen musste, hatte er intern freie Hand. Wie andere hellenistische Klientelfürsten, verfügte auch Antipas über einen eigenen Hof und eigene Gesetze sowie eigene Beamte und Soldaten. So war etwa der „Hauptmann“ in Lk 7,1-10 par kein „römischer“ Offizier, sondern Angehöriger der Truppe des Antipas. Streng genommen war also Galiläa nicht „von den Römern besetzt“, wohl aber Teil des römischen Reichsgebietes. Auch über Antipas schwebte daher das Damoklesschwert, dass ihm sein Reich bei Missverhalten entzogen und etwa in eine Provinz umgewandelt werden konnte, wie es im Jahre 6 nC mit Judäa und Samaria geschehen war, als Antipas‘ Bruder Archelaos nach Protesten einheimischer Honoratioren nach Vienna verbannt und statt seiner der Ritter Coponius als praefectus eingesetzt wurde. Die lukanische Volkszählung hat hier vermutlich ihren historischen Ort.
Dass Galiläa keine römische Provinz war, bedeutete nicht, dass sich alle Bewohner frei und unabhängig fühlen konnten – im Gegenteil. Galiläa war bekannt für vor allem religiös motivierte Insubordination (Judas Galilaeus und seine Söhne in Bellum 2,56; Antiquitates 14,159; Apg 5,37), während Antipas, der neben Galiläa auch das ostjordanische Hochland Peraea regierte, vielen als verschlagener Handlanger Roms galt – sicher nicht zu Unrecht (Lk 13,31f ). Vielsagend ist etwa die Kritik, die Johannes der Täufer, Jesu vermutlicher Lehrmeister in der Predigt vom Gottesreich, an Antipas übte und für die er gefangen und hingerichtet wurde.
Zudem förderte der formal „selbstständige“ Antipas römische Interessen, wie etwa die verhasste Steuerpacht. Bei dieser in Rom weitverbreiteten Inkassomethode wurde die vom fiscus festgelegte Steuerlast einer Provinz, bestehend aus einer Art Kopfsteuer und Grundsteuer, an skrupellose Unternehmer versteigert, die ihre Auslagen entweder mit Gewinn an Subunternehmer weiterverkauften oder sich diese mit großem Aufschlag gleich direkt vom Volk zurückholten. Pfändungen von Besitz und Vertreibung von Eigentümern waren dabei nicht selten. Man kann sich vorstellen, wie verhasst diese „Zöllner“ (Lk 7,34) waren, zumal es sich bei ihnen keinesfalls nur um Nichtjuden handelte. Für manche besonders strenge Juden aber war allein schon der Zwang, Steuern an eine „fremde“, „ungläubige“ Obrigkeit zahlen zu müssen, Zeichen der Unfreiheit und daher Gotteslästerung (Josephus, Antiquitates 18,1).
Auch unter Antipas waren viele Galiläer Erfahrungen von Erniedrigung, Gewalt und Willkür ausgesetzt, obwohl man von ihm gemäß dem hellenistischen Herrscherideal eigentlich Sorge und Wohltaten für sein Volk erwarten konnte. Immerhin hat die Forschung Antipas' Rolle in dieser Hinsicht deutlich nuancieren können: Seine zahlreichen Bauprojekte waren keine willkürlichen Zwangsmaßnahmen, sondern sind im Zuge der generellen Integration der Levante in die römisch-mediterrane Welt zu sehen und haben zu wirtschaftlichem Aufschwung geführt. Dieser zeigte sich z.B. in der Gründung neuer Siedlungen und wachsendem Wohlstand auch auf dem Land . Doch haben sich durch Monetarisierung und Hellenisierung auch die sozialen Spannungen vertieft. In den Evangelien begegnen wir Armut, Krankheit (vor allem Hautkrankheiten oder Blindheit), Prostitution bei Frauen oder unstetes Tagelöhnerdasein bei Männern, beflissenen Gutsverwaltern und korrupten Richtern. Wahrscheinlich aber ging es in Galiläa nicht schlimmer zu als anderenorts in der römischen Welt. Dass diese Themen in der Jesustradition so oft genannt werden, hängt nicht mit vermeintlich besonders prekären Verhältnissen in Galiläa zusammen, sondern eher mit Jesu besonderem Fokus auf den Armen und Ausgestoßenen, der unmittelbar mit seiner Reich-Gottes-Botschaft zu tun hat. Jesu Gott, dessen Herrschaft nahe herbeigekommen ist, will gerade die „verlorenen Schafe“ zurückholen, weil ohne sie das eschatologische Volk Israel nicht komplett wäre und das endzeitliche Freudenmahl mit dem Bräutigam nicht gefeiert werden könnte (z. B. Mt 22,1-4 par Lk 14,15-24). Es überrascht daher nicht, dass Jesus immer wieder mit etablierten Gruppen in Konflikt gerät, wie den „Herodianern“, Pharisäern oder Angehörigen der Jerusalemer Priesteraristokratie (Mk 3,6; 8,15; 12,13; Mt 22,16).
Teil 2 folgt in der kommenden Ausgabe
[Prof. Dr. Jürgen K. Zangenberg ist Professor für Antikes Judentum und Frühes Christentum an der Universität Leiden]