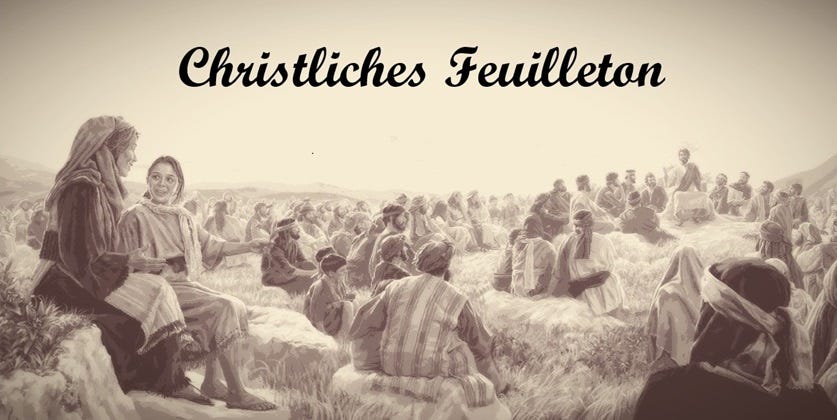Glaube ist viel mehr ...
06.05.2025 ... als ein rot-grüner amtskirchlicher Fanclub
Die evangelische Kirche steht unter bürgerlicher Dauerkritik: Parteipolitisch sei sie allzu einseitig, zudem spirituell rachitisch und bisweilen selbstzerstörerisch. Alles nicht falsch. Doch sie ist noch viel mehr – eine existenzielle und kulturelle Schatztruhe.
Von Till-Reimer Stoldt, in WELT ONLINE, 18.04.2025
Kurz vor Ostern geschah in hunderten evangelischen Kirchen der Republik Großartiges. In Lesungen, Schauspiel- und Gesangsveranstaltungen wurde Besuchern vorgeführt, welche Kraft christlichem Glauben innewohnt: Selbst in äußerster Not kann er Halt und Zuversicht schenken. Der Mensch, an dessen Beispiel dies verkündet wurde, hieß Dietrich Bonhoeffer. An ihn erinnerten vergangene Woche Mittwoch die Kirchen. Exakt 80 Jahre zuvor hatten die Nazis den Theologen und NS-Widerständler hingerichtet. Doch trotz Einzelhaft, zum Himmel schreiender Sinnlosigkeit und Gestapo-Schikane, ja noch im Angesicht des Galgens wusste er sich „von guten Mächten wunderbar geborgen“.
Wie passt das zur (auch hier geübten) Dauerkritik, die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) sei ein rot-grüner Fanklub mit spiritueller Rachitis und autodestruktiven Neigungen? Das passt durchaus. Selbstverständlich hat diese Kirche eine Schlagseite nach links. Und natürlich sind zu viele evangelische Predigten reich an politisierter Luft, aber arm an erbaulicher Kraft. Diese Kritik spießt aber nur einen Teil dessen auf, was diese 18-Millionen-Gemeinschaft ausmacht. Noch immer ist sie zugleich eine existenzielle und kulturelle Schatztruhe.
Diese Einsicht droht unterzugehen. Denn wann taucht die Kirche noch medial auf? Wenn sie auf ihrer Synode Straftäter der „Letzten Generation“ mit stehenden Ovationen ehrt – oder wenn sie eine Ferienfreizeit für „trans*, nicht-binäre und gender-questioning Kinder“ ab acht (!!!) Jahren anbietet. Ja, das verstört. Aber: Die 128 EKD-Synodalen stellen weniger als 0,001 Prozent der Protestanten Deutschlands. Und die erwähnte Queer-Kinderfreizeit ist eine unter Tausenden, die pro Jahr von den 13.000 evangelischen Gemeinden organisiert werden.
Wenn Protestanten ihren größten Komponisten entsorgen wollen
Gewiss, es gibt diese selbstzerstörerischen Klischee-Protestanten. Etwa den niedersächsischen Antisemitismus-Beauftragten Gerhard Wegner, zugleich Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Er forderte nun, das kulturelle Juwel schlechthin der Passionszeit wegzuschmeißen: die Passionen Johann Sebastian Bachs. Sie sollten nicht mehr aufgeführt werden, weil dort antijüdisches Gedankengut auftauche. Tatsächlich wird in den Passionen erzählt, „die Juden“ hätten Jesu Tod gefordert (was in dieser Verallgemeinerung in die Irre führt, weil es natürlich nicht alle Juden waren). Gleichwohl ist diese Forderung aus dem Munde eines Protestanten, so gut sie gemeint ist, acht- und respektlos gegenüber dem eigenen Tafelsilber.