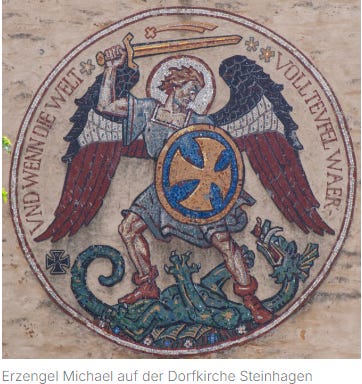Weichgespülte Predigten, Klimaaktivismus, linke Identitätspolitik
20.02.2025 Der Irrweg der Kirche
Die evangelische Kirche muss den christlichen Glauben endlich wieder ernst nehmen, anstatt ihn zu banalisieren und das eigene Profil zu verwässern. Wenn sie Theologie durch Politisierung ersetzt, macht sie sich selbst überflüssig – und bringt die Demokratie um eine ihrer wichtigsten Institutionen.
Die tiefe Krise der evangelischen Kirche ist zu einem Randthema geworden. Dabei sagt sie etwas über den Zustand der Gesellschaft aus, die auf stabilisierende Institutionen angewiesen ist. In ihrem Buch „Vom Glauben abgefallen“ kritisiert WELT-Autorin Hannah Bethke die Politisierung und Banalisierung der Kirche und sucht nach Wegen, die der Kirche wieder zu mehr Relevanz verhelfen. Im Folgenden lesen Sie einen Vorabdruck:
Die Kirche in Deutschland ist am Ende. Auf die unzähligen Missbrauchsskandale folgten Kirchenaustritte in dramatischer Höhe, im säkularen Zeitalter spielt der Glaube keine übergeordnete Rolle mehr, das Bedürfnis nach einem gemeinsamen religiösen Bekenntnis schwindet. Es gibt kaum noch ein Interesse an Religion, geschweige denn an kirchlicher Praxis, solange sie nicht mit einem Skandal oder einer politischen Debatte verknüpft ist. Die Kritik an den Verfehlungen der katholischen Kirche reißt nicht ab und richtet doch nur wenig aus.
Bei der evangelischen Kirche, um die es in diesem Buch geht, liegen die Dinge etwas anders – obwohl es auch hier sehr viele Missbrauchsfälle gab, deren systematische Aufarbeitung gerade erst begonnen hat. Im gesellschaftlichen Bewusstsein aber ist die evangelische Kirche vor allem eines: bedeutungslos. Dabei hat sie selbst zu ihrer Bedeutungslosigkeit beigetragen.
Man kann sogar sagen: Die evangelische Kirche macht in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Sie setzt auf weichgespülte Alltagspredigten, wo theologische Tiefe angebracht wäre. Sie politisiert und diversifiziert sich, anstatt ihr christliches Profil zu schärfen. Sie wirbt in den Gemeinden nicht aktiv um neue Mitglieder, sondern begnügt sich mit den wenigen Schäfchen, die ihr die Treue halten. Der Reformbedarf ist groß, und die seichten Ansprachen der Kirchenamtsträger überschreiten in vielen Fällen die Grenze des Erträglichen.
Das alles ändert aber nichts an ihrer gesellschaftlichen Relevanz. Die Kirche ist eine Institution, die Schutz bietet. Sie stiftet Gemeinschaft unter den Gläubigen und ist der vielleicht letzte Ort, an dem eine gemeinsame Einkehr, Besinnung und Unterbrechung des schnelllebigen Alltags möglich sind. Der Glaube steht heute unter Verdacht. Dabei kann er Menschen in Not Halt und ihrem Leben Sinn geben.
Kirche kann im säkularen Zeitalter immer nur ein Möglichkeitsraum sein. Sie verpflichtet niemanden, sie bietet einen Ort, an dem man bleiben und den man wieder verlassen kann. Im besten Sinne lässt die Kirche niemanden allein. Sie ist eine Institution, die erhalten werden muss, selbst wenn sie das Alltagsleben der meisten Menschen nicht mehr unmittelbar prägt und strukturiert. Institutionen haben eine entlastende Funktion. Sie stabilisieren das Regelsystem einer Gesellschaft und bieten Orientierung. Die gegenwärtige Krisenlage hat eine wachsende Feindschaft gegen Institutionen hervorgebracht. Staat, Kirche, Bildung, all das, was als „Establishment“ firmiert, steht unter Verdacht. Dazu gehören Hetze gegen die Presse, Leugnung von Fakten, Infragestellung der Wissenschaft. Das sind Angriffe gegen die Grundwerte der Demokratie.
Gerade deswegen ist die Demokratie auf starke Institutionen angewiesen. Für die Kirche bedeutet das, ihren Mut zur Eigenart wiederzufinden, den Unterschied zu leben, den sie in einer Gesellschaft zwangsläufig markiert, die mit Glauben und Kirche immer weniger anfangen kann.
Banale Predigten mit privaten Anekdoten
Die Kirche muss sich unterscheiden und abheben wollen – also gerade nicht das praktizieren, was vor allem in offiziellen Verlautbarungen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu vernehmen ist: eine Anpassung an den gesellschaftspolitischen Zeitgeist. Das betrifft etwa den Klimaaktivismus, linke Identitätspolitik und eine Selbstsäkularisierung, die das christliche Profil verwässert. Notwendig ist nicht eine weitere Politisierung der Kirche, sondern eine Theologisierung, die sich wieder stärker auf ihre Kernaufgabe konzentriert. Sie liegt in der Vermittlung der christlichen Botschaft und nicht in der Banalisierung der Theologie.
Bestes Beispiel für eine solche Banalisierung sind gewollt „alltagsnahe“ Predigten. Sie beginnen mit privaten Anekdoten aus der Familie, beliebigen Alltagserlebnissen und spontanen Assoziationen, um daraus ein vermeintlich anschauliches Beispiel für Nächstenliebe und Dankbarkeit abzuleiten oder am besten gleich den Weg zu Jesus zu ebnen, obwohl seine Botschaft sich gar nicht auf solche Belanglosigkeiten bezieht.
Mit der Tiefe der biblischen Geschichte jedenfalls haben all die Bemühungen, die christliche Lehre grob zu vereinfachen und sie inhaltlich auszuhöhlen, sehr wenig zu tun. Interessanterweise führt die ängstliche Anpassung an den Zeitgeist auch nicht zum gewünschten Erfolg. Denn gesellschaftlich werden solche Predigten und kirchlichen Ansprachen jenseits der noch aktiven Kirchenmitglieder nicht ernst genommen. Auf diese Weise ist die evangelische Kirche auf dem besten Weg, sich selbst überflüssig zu machen.
Das vorliegende Buch ist eine Kritik an der Entfremdung zwischen Kirche und Gesellschaft. Wo die Kirche in Auflösung begriffen und als Institution gefährdet ist, bricht in der Gesellschaft eine weitere Instanz weg, die den Menschen eine Werteorientierung bietet und in Krisenzeiten für Stabilität und Verlässlichkeit sorgt. Das wiegt umso schwerer, als wir in einer Zeit tief greifender Umbrüche leben und die Demokratie in Deutschland mitunter scharfen Anfeindungen ausgesetzt ist, während immer mehr Bürger das Vertrauen in die Verlässlichkeit demokratischer Institutionen verlieren. […]
Mein eigener Glaube ist säkularisiert. Das bedeutet für mich zunächst einmal: Ich stehe in der Tradition der Aufklärung und erschließe mir von hier aus Räume der Transzendenz. Sie sind gefüllt durch den Glauben an Jesus Christus, den ich so übersetzen könnte: Es gibt etwas, das höher ist als wir selbst. Der Mensch ist endlich, gebrochen, fehlbar und doch von Gott geborgen. Von einer so verstandenen Demut gehe ich aus, wenn ich als Christin spreche. Ich gebe mein Leben in Gottes Hand und vertraue auf seine Wege. Das bedeutet nicht, sich der individuellen Verantwortung zu entziehen. Es geht darum, das Leben wie den Tod in seiner Gegebenheit zu akzeptieren und mit Gottvertrauen nach dem Guten zu streben.
Gläubig zu sein setzt nicht notwendig voraus, im wörtlichen Sinne an Wunder wie die „leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel“ zu glauben, wie eines der Dogmen der katholischen Kirche lautet. Es ist in seiner Ignoranz gegenüber der Realität einer modernen, säkularisierten Gesellschaft symptomatisch für die katholische Antiquiertheit. Die evangelische Kirche dagegen hat ihre Modernisierung so weit getrieben, dass von ihrer Dogmatik unvermittelt kaum noch etwas zu erkennen ist. Beides weist in die falsche Richtung.
Meine Kritik an einer fehlenden Sichtbarkeit des Glaubens in der Kirche zielt also nicht ins andere Extrem, wo die Beharrungskräfte eines antimodernen, katholischen Dogmatismus wirken. Die evangelische Kirche steht für gesellschaftlichen Fortschritt, Gleichberechtigung der Geschlechter, Demokratie. Hinter diese Entwicklung darf sie nicht zurückfallen. Das entbindet sie gleichwohl nicht von der Pflicht, ihren Glauben zu zeigen, zu praktizieren und am Leben zu erhalten.
Die Kirche muss transzendentale Erfahrung ermöglichen und ihre eigene Religion ernst nehmen. Predigten, die mit Jesus am Frühstückstisch enden oder beginnen, weil man sich bürger- und lebensnah geben will, haben mit ernsthafter Religiosität nichts zu tun. Sie sind eine Verballhornung jener so notwendigen Transzendenz, an der es der entkirchlichten Gesellschaft mangelt.
Der Glaube braucht Tiefe. Nur so können die Menschen aus ihm Hoffnung schöpfen. Der Glaube kann uns Orientierung geben und klare Werte vermitteln. Er schafft ein Bewusstsein sowohl über ethische Grenzen als auch über die Begrenztheit unseres Lebens und Wirkens. Die Kirche ist ihrem Wesen nach Hüterin und Vermittlerin des Glaubens. Als eine Institution der Gemeinschaft entlastet die Kirche den Einzelnen von der Notwendigkeit, alle Fragen des Glaubens, seine Sorgen, Zweifel, Ängste und Hoffnungen mit sich allein auszumachen. Wo das gelingt, vermittelt Kirche die positive Kraft der Religion.
[Hannah Bethke, WELT online, 19.02.2025]